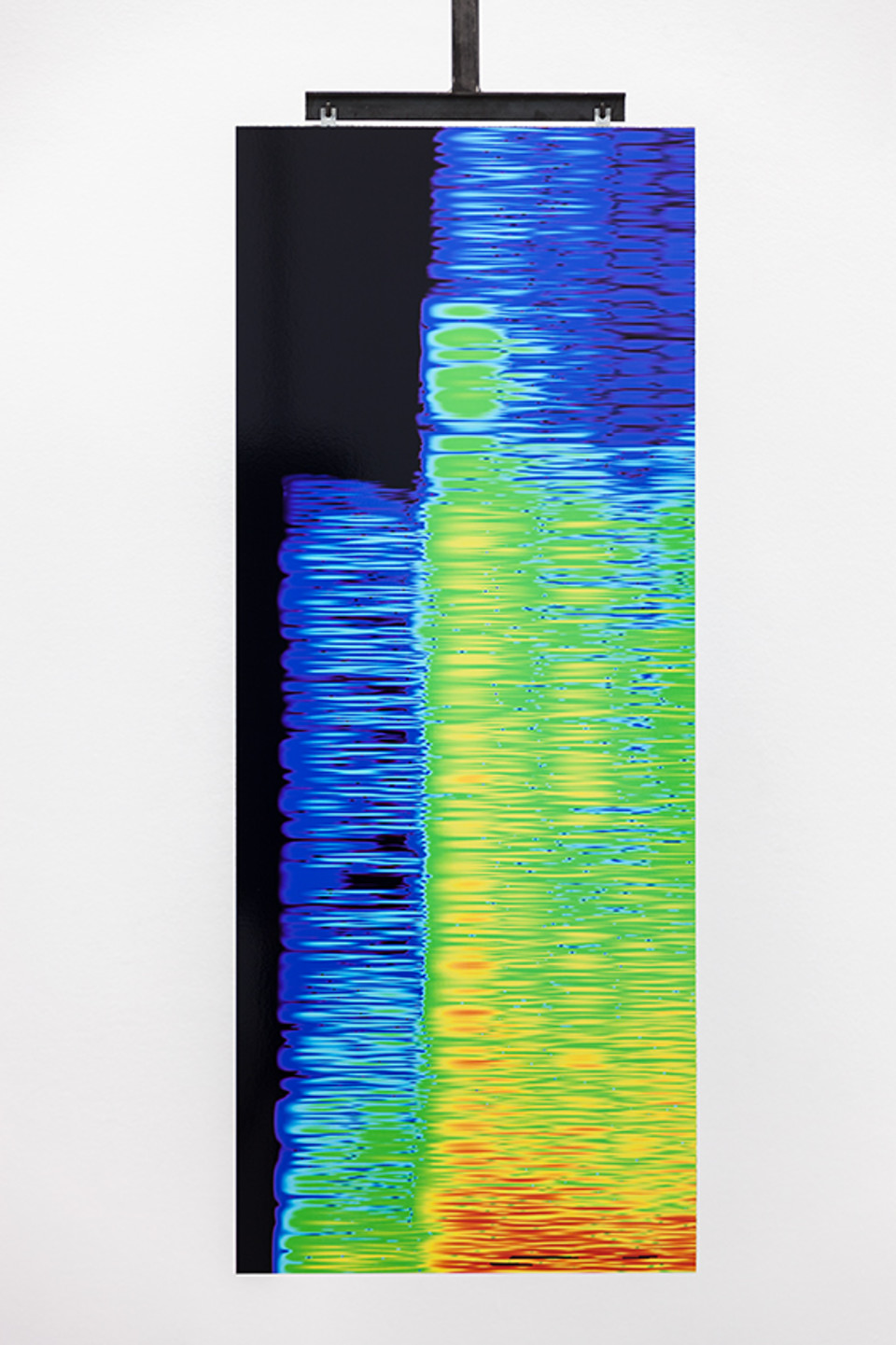Journal
Das Journal auf portikus.de dient als Erweiterung der Ausstellungen im Portikus. Verschiedene Beiträge wie Essays, Interviews, Erzählungen oder Foto- und Videobeiträge vermitteln einen genaueren Blick auf die Interessen der ausstellenden Künstler und reflektieren Themen, die unsere Gesellschaft, Politik und Kultur betreffen.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Jens Gerber
1956 widmete der chilenische Dichter Pablo Neruda der Maispflanze eine Ode. In dieser feierlichen Gedichtform rühmte er die Metamorphosen des Getreides und dessen Einfluss auf das Menschsein. Die „grüne Lanze“, die später von „goldenem Korn“ bedeckt wird, ist ein Symbol der hervorstechenden und kostbaren Pflanze, aber auch Verweis auf die Veränderungen der Maiskultur durch die Kolonialisierung: Eine Waffe bedeutet immer Verteidigung und Schmerz - und Gold weckt Gier. Ab dem 16. Jahrhundert berichteten spanische Chronisten in ihren Überlieferungen über Mittel- und Südamerika von vermeintlichen Landschaften aus Gold. Doch sie hatten die einheimischen Erzählungen missverstanden, die sich mit ihrer Beschreibung nicht auf das Edelmetall, sondern auf Maisfelder bezogen. Noch heute finden sich etwa im urbanen Stadtbild Bogotás Graffitis, die dieses Missverständnis der goldenen Landschaften thematisieren: sie verbildlichen, dass Reichtum als monetärer Wert auf westlichen Weltsichten basiert und somit stark von andinen Ideologien abweicht.
Schon im zweiten Absatz seiner Ode an den Mais formulierte Neruda eine zeitliche Kehrtwende, als er sich selbst ermahnt, statt der „Geschichte im Leichentuch“, das „einfache Korn in den Küchen“ hervorzuheben. Die Künstlerin Ximena Garrido-Lecca (*1980, Lima) setzt in Inflorescence, ihrer Ausstellung im Portikus, genau dort, in den Küchen, dem Alltäglichem an, und vollzieht einen Perspektivwechsel, der bereits bei Neruda anklingt. Über zwei Etagen hinweg lässt sich im Portikus in Frankfurt die kulturelle Bedeutung von Maispflanzen aus unterschiedlichen Blickwinkeln nachvollziehen. Dabei betont die Künstlerin, wie Mittel- und Südamerika als Ursprungsgebiete der Maiskultur in der Geschichte oft nicht genug Berücksichtigung fanden und arbeitet gegen die in den kolonialen Chroniken dominierende Tendenz die Entwicklungsgeschichte lokaler Pflanzen zu übergehen und somit die landwirtschaftlichen Fähigkeiten und Errungenschaften einheimischer Kulturen abzuwerten.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Jens Gerber
Die Blütezeit von Maispflanzen dauert in Mitteleuropa von Juli bis September. Geerntet werden die Gräser und Kolben bis in den späten Oktober hinein. Für ihre Ausstellung im Portikus reagiert Garrido-Lecca auf die lokalen Bedingungen der Nutzpflanze und stellt sie in unterschiedlichen Erscheinungsformen aus. Ob aufrechtstehende, zu Bündeln zusammengefasste oder an der Wand lehnende Gräser, stabil in Metallrahmen gefasste Maisspindeln, die als Sitzmöglichkeit dienen oder ein mit reifen Kolben bestückter Wandkasten: Mais ist Hauptmotiv und -material von Inflorescence und dient der Künstlerin so als Mittel um über die gegenseitige Einflussnahme von Mensch und Natur zu reflektieren. Überragt werden die Skulpturen aus gebündelten Maispflanzen von Antennen, wie sie aus der Telekommunikation bekannt sind. Sie stechen aus den Bündeln heraus – als wären sie selbst Teil des Trocknungsprozesses. Technik und Natur sind nicht mehr voneinander zu trennen, sondern gehen ineinander über. Die Herausforderungen, die aus dieser neokolonialen Verschränkung resultieren, werden ebenso in den die Ausstellung begleitenden Radioübertragungen vielstimmig besprochen und mit ökologischen, sozialen, biologischen sowie politischen Aspekten vertieft: Der Wunsch nach Sortenvielfalt und ökologischen Anbaumaßnahmen auf der einen, und dem stetig wachsenden Verbreitung von Genmais 1 auf der anderen Seite ist ein Paradox, dessen Ausmaß beim Zuhören greifbar wird. Die Antennen stehen so symbolisch nicht nur für globale Vernetzung, weitreichende Kommunikation und Wissenstransfer, sondern, in ihrem Verhältnis zum Mais, auch für anhaftende Ambivalenzen. Teils strahlenförmig, mal gitterhaft suggerieren deren schimmernden Stäbe ein anthropologisches Ungleichgewicht; materialspezifisch ist klar, dass das Aluminium die Pflanze überdauern wird.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Max Creasy
Die versetzte Zeitlichkeit von Natur und Technik im Kapitalismus wird auch in Bezug auf die traditionsreiche Anwendung von Mais im Alltag deutlich. Mexiko und Peru waren vor fünftausend Jahren die ersten Länder bzw. Regionen in denen Mais domestiziert wurde. Seither ist er tief in die Kulturgeschichte und Kulinarik beider Länder eingeschrieben: Mexiko ist etwa berühmt für seine Mais-Tortillas, Peru für das nahrhafte Kaltgetränk Chicha de Jora, das aus fermentiertem Mais hergestellt wird. Aspekte dieser Weiterverarbeitungen werden in Inflorescence durch einen Mahlstein, oder auf den Stockwerken verteilte Schalen, Teller, Bottiche und Krüge materialisiert. Die Gebrauchsgegenstände stehen für eine fortlaufende Praxis der Maisverarbeitung und -einverleibung als Teil einer Gegenwart, in der sich lateinamerikanische Landwirt*innen politisch für den Erhalt der Traditionen ihrer Gemeinden, die Vielfalt des Saatguts und das Recht auf Ernährungssouveränität einsetzen. Kommunale Formen der Organisation, die in den letzten Dekaden vermehrt vorkommen, leisten hier Widerstands gegen Unterdrückungsdynamiken.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Max Creasy
Deutschland hingegen kann sich nicht auf eine traditionsreichen Maiskultur berufen. Erst seit den 1970er-Jahren wird dort großflächig Mais angebaut – hauptsächlich als Rohstoff, z.B. für Tierfutter, Bioethanol oder Klebstoff. Indem Garrido-Lecca für ihre Skulpturen den Mais aus Nordhessen aus eben jenen Verarbeitungsprozessen herauslöst, verknüpft sie so lokale und globale Aspekte des Ausstellungsortes wie etwa Transportwege oder saisonale Bedingungen miteinander und zeigt ebenso die immensen kulturellen und historischen Unterschiede im Umgang mit natürlichen Ressourcen auf.
Die geografische und zeitliche Linse von Inflorescence, hilft sich in den postkolonialen Diskursen um Mais zurechtzufinden. Diese beinhalten die Frage nach Territorien und Besitzansprüchen, aber auch nach der Aneignung von kulturellen und kulinarischen Traditionen, die auf dem Mais als Nahrungsmittel aufbauen. Das Aufgreifen, Arrangieren und Inszenieren der Pflanzen und -kolben ist demnach von der Künstlerin um die transhistorische und transkulturelle Bedeutung des Mais zentriert, die im mitteleuropäischen Alltag zu großen Teilen ausgeblendet bzw. der kein Gehört geschenkt wird. Auch deshalb stattet Garrido-Lecca die nordhessischen Maispflanzen mit Megafonen aus, die den Portikus mit einem konstanten Wummern akustisch einnehmen. Als Beleg für die jahrtausendealte Maiskultur und deren Zugehörigkeit, funken gleichmäßige Morsecodes eine Erzählung der mexikanischen Maya-Kultur in den Ausstellungsraum, die besagt, dass der Mensch vom Mais abstammt. Damit der Inhalt aber als solcher identifizierbar ist, braucht es einen Schlüssel zum Verständnis, ansonsten bleiben die gemorsten Inhalte lediglich ein hintergründiges Störgeräusch.

Ximena Garrido-Lecca, 'Inflorescence', Installationsansicht, Portikus, Frankfurt am Main, 2023, Foto: Max Creasy
Franciska Nowel Camino ist Kunsthistorikerin und derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der HfBK Dresden. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der postkolonialen Rezeptionsgeschichte andiner Textiltechniken. Sie studierte Kunstgeschichte, Romanistik und Archäologie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und arbeitete in der Graphischen und Digitalen Sammlung des Städel Museums sowie am Frankfurter Studiengang Curatorial Studies – Theorie – Geschichte – Kritik. Ihre Texte sind bisher in Sammelbänden, Ausstellungskatalogen, Online-Magazinen und dem AKL erschienen.
Logbuch Diversion
SEPTEMBER 22
A person and I were sitting at the wooden table downstairs when they asked me what’s happening in this room and I reply not intentionally repeating the question and also adding another one to see if they’ve read the newspaper or not I wanted to start the conversation asking what was their favorite part of it if there was one usually there is one but they reply I'm coming from my reading group my favorite activity they’ve said so I can't read anymore I'm blind I'm old but I will do it tomorrow or when I'm able to see again I'm going to rest my eyes the rest of the day so I went back to their question and walked with them to the water station they talked about seasons and I felt that’s all we talk about in the transition between one and the other but especially this one maybe in the north hemisphere after they have tried the river and said that in a warm day that could second them they will not doubt getting wet feet upstairs we said goodbye goodbye
SEPTEMBER 20
A boy came with a bag of chestnuts and asked if he can put one of them in the river and play with it. Later in the afternoon a friend came to visit the show with a chestnut too. It’s the season now. When the sun shines in during sunset, it leaves marks of shadow and light on the wall not seen in those summer months. Very soon this temporary river in Portikus will be gone, leaving stories behind like chestnuts falling from trees in autumn. - YX
SEPTEMBER 17
I was asked to make photos of the visitors three times today. It's such a simple and andom fact about today's shift but it made me think of how each time all of them were photographed with a different river in the background. Because it's flowing, it's everchanging, it's never the same water. - HL
SEPTEMBER 16
A river flow down each cheek of the visitors today because it‘s raining. The proud mother of a swimmer came to follow his tracks. Someone ask me what are the biggest flows of water I have seen? - HS
SEPTEMBER 13
The water stream has changed its colour today, wearing silver on its ripples. The blank skies and reflective waves, along with the bluish tree leaves are directing my mind to play out the Twin Peaks theme soundtrack in my head over and over, and I can’t help but listen to these synths as i stare at those trees. - RA
SEPTEMBER 11
Today is the 800th anniversary of Alte Brücke! Happy Birthday! - MG
SEPTEMBER 10
Portikus was a shelter for people when it rained. - ES
SEPTEMBER 9
Today Barbara visited us again - don't know exactly how many times she has already been to the exhibition but it was already the second time we saw and talked to each other: about Berlin and the Berlin Wall, how it was for her to grow up near the border of Germany, France and Switzerland, how as a kid she would go into the water whenever possible…And suddenly I've spotted a quirky playful smirk in her eyes - 'ich habe eine Idee!' . And the next moment she started folding the small paper she took out of her bag into a paper boat, doing it so quick and professionally as if she makes those every day. The boat's life was short but glorious. Barbara promised to come back with a toy boat next time. - HL
https://drive.google.com/file/d/12Mx2MxsZ5JK2MLioIAOiR-oV1aKdlto6/view?usp=sharing
SEPTEMBER 8
I dipped my toes into the water with a stranger. - ES
SEPTEMBER 7
Clouds took over the river today, leaving it greener in contrast. I had a nice conversation with a lady who stumbled upon the waters and decided to see it for herself. We spoke about swimming friendly bodies of water and I learned about an ancient one that still has the built stairs and traces of people back in the day. Added to my list of things to see in frankfurt. - RA
SEPTEMBER 6
The sun left its mark in the hall, forming a long line of squares on the floor. It was a bit distracting to look at. A couple of old men walked in, curious to look at the water and thrilled when finding out that they could walk in there. One of them transformed into a child the minute his feet touched the running stream. He said as he was leaving with excitement: it’s a blessing! - RA
SEPTEMBER 4
Today we had Martin Scheuermann from the company who printed the newspapers visit the show with his wife. E and I made an effort to show them around and make them feel welcome. They emphasized that they enjoyed the exhibition and the whole message it sends. First they were hesitant to get into the water, but they adjusted really fast and said how refreshing it felt. They also drank the water downstairs. He said to give a special thanks and compliments to C & L. - MG
SEPTEMBER 3
We found traces of the passing summer in the water. - YX
SEPTEMBER 1
Today the sun was a rare guest in the gallery. As if somebody adjusted the light settings and suddenly the world around has lost a bit of colour and saturation. It also does something to the water although it is transparent. I don't really believe calendars but looks like September likes to be punctual. - HL
AUGUST 30
A woman told me the story of how she grew up opposite the island where Portikus is, looking at the building that existed before it and wonder whether it was a church or a windmill or something else. Then she moved away from Frankfurt. And today she visited Portikus for the first time and tasted the river.
Now the wind brings in fallen leaves too. - YX
AUGUST 28
Since the festival is still going, there are a lot of visitors coming in and out. Our river is a place for them to relax and take a breath. - MG
AUGUST 27
The most common question I've heard today was 'What's going on here?' ('Und was ist denn hier los?'). Yeah, exactly - it's GOING (also running, streaming,changing, rushing, moving etc.) and it is already enough information about this artwork. This was the answer I had in the back of my mind but I never said it out loud. - HL
AUGUST 26
Everything is painted grey today, from the water of the Main to the floors of the Portikus. After yet another brutal heatwave last week it has finally cooled down, and the wind is whipping jitters into the river. Very likely also the reason less people feel the desire to step into the water. - NL
AUGUST 25
As one of the visitors was surprised by the temperature of the water (she didn't expect it to be so warm), I thought of how surprising it actually is - barely a week before September kicks in. In the pagan tradition (or at least in a Slavic version of it as I'm aware of), you're not recommended to enter any streams, rivers or lakes after August 2 because from this day on the waters are occupied by devilry and other dangerous creatures and the season of cold rainy weather starts. Seasons have changed greatly ever since and the waters can be cleansed by the human. Guess our ancestors would find it very safe but not as exciting anymore. - HL
AUGUST 24
A man with big green Aldi bag coming in with a calming smile. He looks like he is on his way to grocery shopping. Then he sat down by the river, closed his eyes, crossed his legs and started chanting. A quiet afternoon. - YX
AUGUST 23
Two friends entering the water together. After some minutes they hugged each other with their feet still in the water. - ES
AUGUST 21
The mystery foam is still appearing in the bucket. The mystery of foam remains the mystery after the two sunny non-even-close-to-rainy days. I would call this foam a 'cloud' - giving such a poetic name should eliminate the visual ugliness and disgusting smell this foam actually has. The foam of mystery is what I created in my head while looking at a pathetic smelly gathering of bubbles appearing as a result of intense waterfall. - HL
AUGUST 20
Today we had a couple visit us who were blind. I helped them find their way. Once they were in the water, H and I discussed how most art is not accessible for everybody. Here we had the chance to create an experience for them that went way beyond a visual reception. I am very thankful to be a part of this moment. – MG
AUGUST 19
A lady with a mysterious smile came in. Our conversation started with her asking the gender of the artist of the show ( she is the first person asking me the question). Then we began to talk about tenderness, theology and Rudolf Steiner (and many more). The water carries the story and goes on. - YX
AUGUST 18
I discovered that a pigeon has made a nest underneath the bridge, a butterfly flew through the front doors and then out again. I check the duck eggs in a nest on the island from the door in the basement. I’m now becoming more familiar with the small parts of nature which inhabit the island. – ES
AUGUST 11
did you ever see anyone washing clothes in this river? – NN
AUGUST 2
Towards the end of the day, just before our river was supposed to stop flowing, Francisco told me that someone had vandalized our toilet. At first I thought he was joking with me, referring to the Wallace Stevens poem affixed to one of the doors, but then he showed me a bright green sign in the other cabin. We tried to decipher it, but didn’t get far. Maybe someone didn’t want the river to stop flowing or wanted to challenge our water’s ability to remove graffiti. - CB
JULY 31
First shift data
Water level: 153 cm
Water temperature: 24,8 *C
Number of visitors: 231
- MG
JULY 30
The sky is completely clear today and hot air is filling the room. I saw a family come in with their child. They helped the child walk in the water, holding hands and laughing together. It was a very beautiful moment to witness. - MG
JULY 29
When I came to Portikus today, it was melting hot outside and I felt relieved to go into the PortikusMain. Meanwhile it started pouring and it has gotten colder and windier - it’s even better now. The atmosphere has changed completely. - RH
JULY 26
I sat close to the riverbed and got lost in the rushing of the water until I was told the apodictic sentence that this wasn't the real Main. I was a bit surprised and asked for the real one. We went to the window and he pointed to the water flowing around the Main Island. I asked more questions, interested to know what and where the real Main is. At one point I told him that I lived in Offenbach and that I liked sitting at the lock and that the surging water fascinated me. In doing so, the visitor began to sway, the artificial interruption of the Main undermined his view of the real Main. We were silent for a moment. I then sat down again by the riverbed - and the visitor sat down with me. - NF
JULY 24
The sun is really strong today. Being in the water feels even more refreshing than it usually does. I ended up talking to a visitor for an hour. Somehow the conversation transformed from the phobia of swimming in natural waters where the floor is hidden in the dark, to discussing cyber security and the impact of social media on our everyday lives. - MG
JULY 15
A woman told me today that there’s a waterwork in Schwanheim that also purifies the Main water and serves it to its guests. I wonder if they also show us step by step how they filter the water…
Anyway, there was a huge family visiting the exhibition today and RA and I had interesting conversations with them of course about rivers and bodies of water. They told us about a black river in Syria. - RH
A women came to me asking me about the stones that we use for mineralizing the water. It turned out she is a jewelry designer and has a lot to share about how stones bring different energy to the substance they are in contact with. I enjoyed this moment of exchange. - YX
JULY 9
Towards the end of the day a cloud gathered, and the air became close as if a storm was about to break, it turned cold. The water running through the space kept a warmth, which surprised visitors as much as it did me. - ES
A glimmering surface seduces when walking past Portikus on the bridge. Lot’s of visitors throughout the early hours of the day. Conversation flowed in many different directions, from aquatic monkeys to horses dragging pilgrims along the main. Today, our miniature Main felt like a ceremony, I don’t yet know of what. - AS
JULY 8
The thick weather pulled people in today. They came in waves, mostly in groups. I found myself having conversations almost constantly in water. The skin on our feet like raisins. Two smaller persons and I were playing wild in the water for quite a while. The water was the best they ever tasted, they said. Tasting mineraly, a characteristic taste, of it’s own, flowing through us at that moment. - AS
JULY 3
Today‘s information about the water:
Total hardness: 0ppm
Free Chlorine: 0ppm
Iron: 0ppm
Copper: 0,5-1ppm (above average level)
Lead: 0ppm
Nitrate: 0ppm
MPS: 0ppm
Total Chlorine: 0ppm
Fluoride: 0ppm
Cyanuric Acid: 0ppm
Ammonia Chloride: 100ppm (above average level)
Bromine: 0ppm
Total Alkalinity: 0ppm
Carbonate: 40-80ppm (below average level)
Ph: 7.2-8
- RH
JULY 1
I had a conversation with a person that comes from Spain, Catalonia and lives near a river where you can drink the water since it’s so clean. I was several times in that region, close to a river called Muga where I could drink the water, too. We had a connecting moment while we both we‘re standing in the Main. - RH
JUNE 30
I learned about the de-humidifier today. We have to always keep it running and we’re emptying it in the mornings and evenings. The ventilators have to stay on too. The de-humidifier is preventing the walls in the gallery from getting moldy. When I imagined the mold on the white walls I had to think about how it would look if the walls had been layered with actual moss, with creeper plants and ivy. - RH
JUNE 29
Noticing the pipes shudder with the flow of water it directs. The pipes are as if they were the intestines of the show. A young child runs through the water. Later some visitors are curious about the engine, pumping the water up, so I take them outside to show them the heart of the work. They were in Frankfurt from LA. - ES
JUNE 28
Upon inviting a visitor into the water with me he quickly takes off his shoes, steps into the water and takes a deep breath while closing his eyes. - MG
JUNE 26
It's warm in Frankfurt, almost 30 degrees. The banks of the Main are well frequented. In the direction of Offenbach it gets quieter. If you take your time tomorrow, you will see the water changing its colors: A visitor drew my attention to the fact that the many colors a river takes on and can take on over the course of the day are rarely emphasized. The color changes with every minute, with every wave. I've been told that those who are susceptible don't need a treasure map. I'll sit down at the Main tomorrow. - NF
JUNE 25
The river pulled many people into space today. I only realize how the sound bounced all around throughout the day when I finally meet the silence at the end when closing. Outside the streets were littered with people which spilled into the space. The footfall was faster than the river. The air was warm, around 25 degrees, yet the gallery stayed fresh. For that freshness, I am grateful.
JUNE 24
Opening day. Heavy rains and thunder from 18.00 rounding up a hot and mostly grey day. 26 degrees most of the time. The low pressure making the water feel even warmer. Doors and windows open on both sides of the gallery creating a counter stream of air to the water flow. Successful event.- HS
JUNE 23
The fresh air around Portikus is stolen again, smells like rain with thunder but weather tricks us over and over. Our local tiny Main had a lot of visitors today, as soon as they put their feet into the water the gallery started to remind me moreand more of a children's playground. The buzzing sound of chatting and laughing backed with the sound of a water flow till midnight and some time after. - HL

Orangenschalen, die im Portikus Garten trocknen
JUNE 22
It’s very nice today. I peeled oranges and lemons. My hands are still smelling like them. It felt very meditative to peel in stillness in the garden. The set is coming slowly to an end. I am excited for the opening. I was singing before with AS to lyrics that AR gave us. It felt very nice to sing. - RH
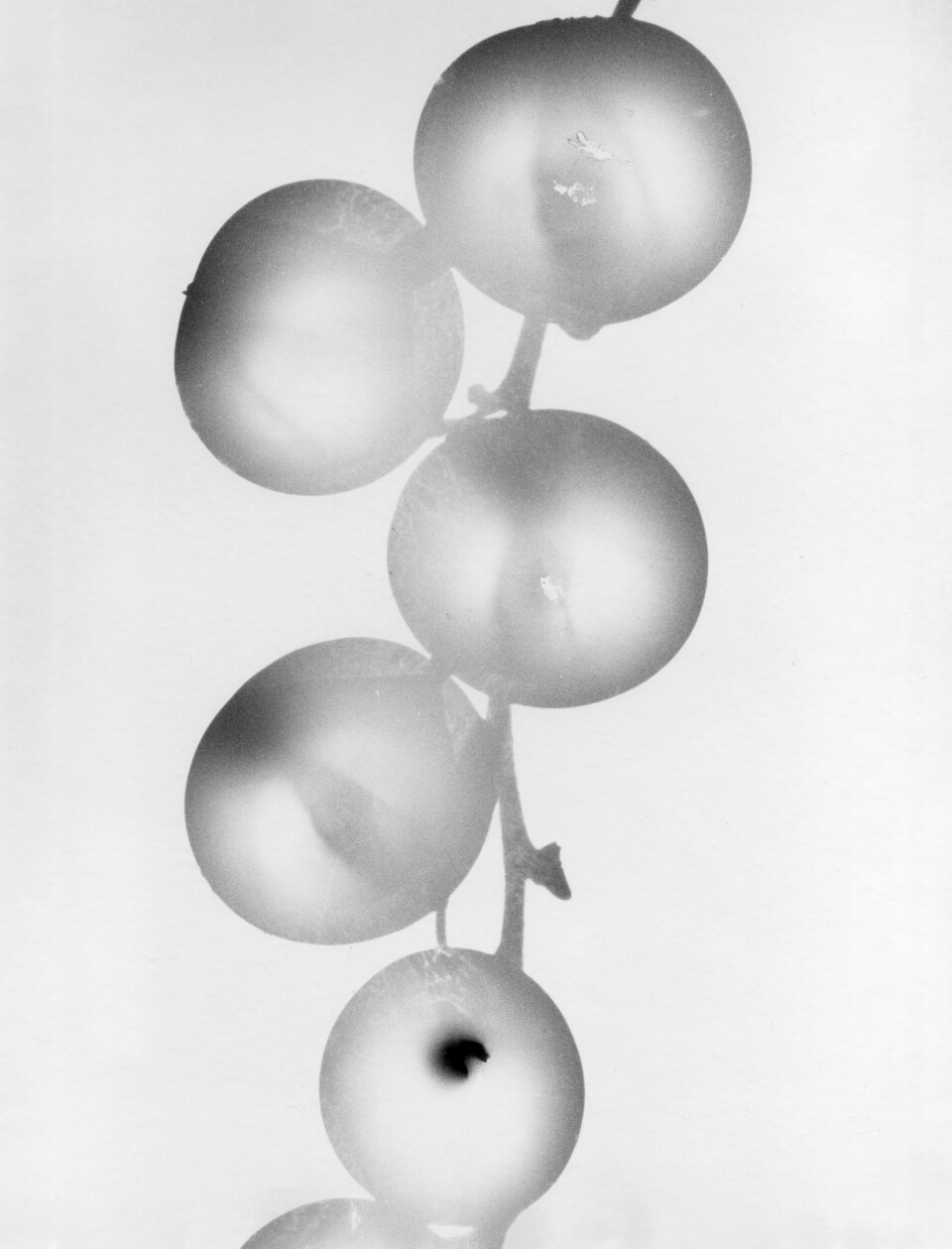
Jochen Lempert, Johannisbeeren, 2019, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy: BQ, Berlin, und ProjecteSD, Barcelona
Niemand ist gedankenloser als ein Lemming, hinterlistiger als eine Katze, sabbernder als ein Hund im August, stinkender als ein Ferkel, hysterischer als ein Pferd, idiotischer als eine Motte, schleimiger als eine Schnecke, giftiger als eine Viper, weniger phantasievoll als eine Ameise und weniger musikalisch als eine Nachtigall. Einfach ausgedrückt: Wir müssen diese und andere Tiere für das, was sie sind, lieben – oder, wenn das ganz und gar unmöglich ist, zumindest respektieren. 1
— Umberto Eco
Jochen Lemperts Fotografien beginnen mit einer Begegnung, dem Zusammentreffen realer oder künstlicher Darstellungen von Pflanzen und Tieren in städtischen oder ländlichen Umgebungen, Museumsausstellungen, wissenschaftlichen Büchern oder auf der Kleidung eines Passanten. Flora und Fauna in seinen Bildern scheinen zu interagieren, neigen sich zur Kamera oder verhalten sich völlig gleichgültig gegenüber seiner Anwesenheit. Diese Bilder haben Lempert Anerkennung als Künstler eingebracht, der sich für die Art und Weise interessiert, wie die Natur für uns gegenwärtig wird. Diese scheinbar unauffälligen Begegnungen des Alltags werden, sobald sie fotografiert sind, zu großartigen Trägern von Enthüllungen, die von der Darstellung der schelmischen Natur der Tiere bis hin zu den majestätischen Schatten reichen, die das von der Sonne geküsste Blätterwerk wirft. Lemperts Bilder haben eine Leichtigkeit, eine Nähe, die davon zeugt, dass er sich mit den kleinsten Insekten oder zerzausten Vögeln wohlfühlt, die uns Zugang zu ihrer Existenz gewähren. In seinem Werk werden Ähnlichkeiten zwischen Organismen, himmlischen oder irdischen Phänomenen mit emotionaler Intelligenz betrachtet und zum Ausgangspunkt für Bilder, welche die Verbundenheit der Natur offenbaren. Sein Interesse an wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere der Biologie und dem Verhalten von Tieren, schlägt sich in Bildern mit metaphorischem, assoziativem und politischem Scharfsinn nieder und ermöglicht, fast intim auf andere Arten zu blicken, mit denen wir das Leben auf diesem Planeten teilen.

Jochen Lempert, Installationansicht, Portikus, 2022, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy: der Künstler, BQ, Berlin, und ProjecteSD, Barcelona; Fotografie: Diana Pfammatter
Seit drei Jahrzehnten verfolgt Lempert mit bemerkenswerter Konsequenz und Einfallsreichtum den Grundgedanken, Bilder nur nach einem Prinzip der Notwendigkeit zu machen. Obwohl er dafür bekannt ist, stets eine Kamera in der Jackentasche zu tragen, findet der Akt des Bildermachens bei ihm erst lange nach dem ersten Klick des Auslösers statt. Der Großteil seiner Arbeiten entsteht nicht auf Kontaktbögen. Er wählt direkt von den Negativen aus, wobei er oft nur ein Drittel oder weniger der Bilder einer Rolle verwendet. Mit Hilfe von Arbeitsabzügen, die er im Format A5 oder kleiner anfertigt, mischt er verschiedene Varianten und studiert sie, bevor er sich auf eine bestimmte Größe, einen bestimmten Ausschnitt oder ein bestimmtes Licht festlegt. Eine Folge dieses akribischen Bearbeitungsprozesses ist, dass das Sehen selbst zum Gegenstand der Arbeit und zur Methode des Zeigens wird. Jedes von Lemperts Werken ist die Summe allmählicher Entscheidungen, die zur Entstehung eines Bildes führen. Seine Fotografien, in erster Linie Silbergelatineabzüge, werden von ihm in seinem Atelier in analogen Farbschemata von Grautönen auf mattem, strahlend weißem Barytpapier selbst entwickelt und bleiben ungerahmt, wenn sie an die Wand geklebt oder in Vitrinen ausgestellt werden. Ob für eine Ausstellung oder eine Publikation, Lempert zieht es vor, ältere und neuere Werke nahtlos zu kombinieren
und so ein Werk zu schaffen, das eng miteinander verknüpft ist, bewusst anachronistisch, und in welchem Entscheidungen über Paarungen und Gruppierungen durch einen relationalen Antrieb eingefügt und neu formuliert werden. Diese assoziative Herangehensweise an das Kunstwerk findet sich auch in den Titeln seiner Werke wieder, wobei er einzelne Substantive oder beschreibende Sätze bevorzugt, die der Betrachterin unnötige Ablenkungen ersparen sollen, um die Erfahrung vor dem Bild auf das zu beschränken, was der Künstler als etwas bezeichnet, „das man im Moment des Sehens stark spürt“ 2

Jochen Lempert, Schmetterlingshafte, 2019, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy: BQ, Berlin und ProjecteSD, Barcelona
Auf dem Spielfeld der zeitgenössischen Kunst ist Lempert ein begnadeter Außenseiter. Seit Anfang der 1990er Jahre stellte er seine Arbeiten in Köln und Hamburg aus, und abgesehen von gelegentlichen thematischen Gruppenausstellungen zirkulieren sie vor allem in den Sphären der Fotografie, wenn auch mit Argwohn hinsichtlich seines unkonventionellen Umgangs mit dem Medium. Sein gleichzeitiges Einbeziehen verschiedener fotografischer Verfahren, von der Augenblicklichkeit bis zur Inszenierung, die er durch die wiederkehrende Verwendung von Multiples in sequenzieller Reihenfolge miteinander in Einklang bringt, positioniert das Werk unabhängig von üblichen Kategorisierungen. Ein weiteres Kuriosum im Zusammenhang mit der öffentlichen Rezeption von Lemperts Praxis, und besonders in seiner Verwendung einer 35-mm-Kamera, ist die wiederholte Bezugnahme auf die wissenschaftlichen Qualifikationen des Künstlers. Sein Name wird in der Regel von Titeln begleitet, die ihm eine zusätzliche Ebene der Außergewöhnlichkeit verleihen: Biologe, Odonatologe, Entomologe oder Ornithologe. Es ist zwar kein Geheimnis, dass er von Zeit zu Zeit wissenschaftliche Berichte verfasst hat, doch wie weit diese Studien von seiner Arbeit entfernt sind, wird durch ihr völliges Fehlen in seinen Ausstellungen und Monografien bestätigt. Dass derartige Klassifizierungen für den Künstler von Belang sein könnten, ist eher unwahrscheinlich. Lempert interessiert sich wenig für nachweisbare Fakten und auch sein Arbeitsprozess wird nicht von festen Strukturen oder Theorien bestimmt, sondern ist ein offenes System, in dem, wie er bemerkte, „[d]ie Suche […] ein großer Teil des ganzen Projekts [ist]“ und in dem unbegrenzte Ergebnisse in jedem Schritt des Weges plausibel sind.3 In seiner fotografischen Arbeit schweigt Lempert aktiv zu den Naturwissenschaften. Anstatt seine wissenschaftlichen Kenntnisse auf das anzuwenden, was er fotografiert, lädt er visuell zur Bedeutungsfindung durch den Akt des Sehens ein – den Akt des Sehens von dem, was abgebildet ist und darauf wartet, sichtbar zu werden.
Ein weiterer auffälliger Aspekt innerhalb von Lemperts Praxis ist sein Atelier oder vielmehr dessen Wände, die eine große Anzahl kleinerer Hohlräume aufweisen, die von den Reißnägeln herrühren, die er zum Anheften von Arbeitsabzügen verwendet. Die in verschiedene Richtungen verlaufenden Spuren zeigen seine jahrzehntelange Suche nach einem Bild. Die Platzierung der Abzüge an der Wand wechselt zwischen Einzelfotografien, symmetrischen Gruppierungen, bei denen gleichgroße Abzüge zu Duetten, Quartetten oder zweigliedrigen Rastern mit nur wenigen Zentimetern Abstand gepaart werden, und asymmetrischen Paarungen, bei denen Abzüge unterschiedlichen Maßstabs im Dialog, jedoch im Abstand einer Armlänge zueinander platziert werden. Die verschiedenen Kombinationen und Konfigurationen, die im Atelier entstehen, beeinflussen die Improvisationen, die auf den Wänden der Ausstellungsräume umgesetzt werden. Aber dies ist nur ein Aspekt seiner Suche. Ein weiterer wichtiger Teil des Prozesses findet in der Dunkelkammer statt, bevor ein Abzug an die Wand kommt. Der Künstler hat es so erklärt: „Es geht eigentlich immer darum, anhand des Fotos etwas zu sehen oder auf dem Foto etwas zu sehen. Manchmal braucht man dazu mehrere Bilder, damit etwas zusammenkommt. Und manchmal reicht nur eins.“ 4

Jochen Lempert, Installationansicht, Portikus, 2022, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy: BQ, Berlin, und ProjecteSD, Barcelona; Fotografie: Diana Pfammatter
Wenn die Wand die Bühne ist, auf der Lempert probt, dann sind die kleinen Pappschachteln mit den Arbeitsabzügen, die in den Regalen stehen, das Casting. Hunderte von Abzügen in der Größe von Karteikarten sind in Sammlungen gruppiert, geordnet nach einzelnen Wörtern in deutscher Sprache, die eilig auf Notizzettel geschrieben wurden und zum Beispiel lauten: H2O, Pferde, nur Bienen, Tauben, Pflanzen, Himmel, Wind. Andere gehören eher zu metaphorischen Kategorien, die auf bestimmte Konstrukte anspielen, wie: Bildlogik, Symmetrie, Sinne und Gestalt. Lemperts Sammlung von Arbeitsabzügen funktioniert anders als ein Aufbewahrungsort; sie hat sich zu einem Lexikon entwickelt, das er verwendet, modifiziert und von dem er entlehnt, um das zu schaffen, was er „Konstellationen“ nennt, in denen die Art der Präsentation an einer Wand oder in einem ganzen Raum einen Dialog etabliert. Wenn die Arbeitsabzüge ihm Antworten auf die Frage geben, welches Bild behalten werden soll, erweitern die daraus resultierenden Gruppierungen die Bedeutungskonstruktion durch Gegenüberstellungen und Vergleiche. Lempert geht durch hypothetische Platzierungen intuitiv vor und unterscheidet die Bilder nach keinem vorgefassten Plan. Daher sind alle Szenarien provisorisch, außerhalb der Chronologie stehend und der schnellen Überraschung einer Erscheinung unterworfen. Auch wenn es Paare gibt, die sich durch seine Improvisationen ergeben, ist jede seiner Installationen ortsspezifisch, d. h. vor Ort inszeniert und darauf ausgerichtet, Verständnis gerade für ihre flüchtige und austauschbare Bedeutung zu erzeugen, die permanent gegenwärtig ist.
Im Zentrum von Lemperts Arbeit steht eine radikale Ökologie, die durch eine Praxis des Verstandes, der Hände und der Augen gekennzeichnet ist. Durch die Verwendung von Bildern, bei denen die Welt kein Ort ist, den es zu erfassen gilt, sondern ein Terrain der Korrespondenz, macht er Begegnungen mit der Natur und nicht-menschlichen Wesen sichtbar, bei denen eine Übertragung und Koexistenz stattfinden. Lemperts Annäherung an die Natur aus furchtloser Nähe ist herzlich und respektvoll, doch vor allem einfühlsam. Seine Bilder lehren uns nicht, was wir betrachten sollen, sondern wie wir die Arten, mit denen wir auf diesem Planeten zusammenleben, sehen können. Seine Interaktion mit der Umgebung spiegelt sich auch in seiner Suche nach Beziehungen in den Bildern wider. Für Lempert ersetzt die Fotografie die Erfahrung der Natur nicht unbedingt als Natur in Abwesenheit, sondern visualisiert sie als Präsenz. Unsere Wahrnehmung konvergiert mit Lemperts intimer Nähe zu seinen Motiven, wenn wir uns ihm in der Bejahung der Würde aller Lebewesen anschließen. Seine sich überschneidenden Interessen in Kunst und Wissenschaft konvergieren in seinem Werk als Darstellungen, die von der Welt, die wir bewohnen, nicht getrennt sind, sondern eher zu ihr gehören, so dass die Fotografie als Blätterwerk der menschlichen Erfahrung erscheint.
Aus dem Englischen übersetzt von Holger J. Jakob
Im Rahmen der Ausstellung Pierre Verger in Suriname lädt Willem de Rooij die Künstler*innen Razia Barsatie, Ansuya Blom, Ruben Cabenda und Xavier Robles de Medina ein, ihre Werke auf der Portikus-Website zu zeigen. Das Programm Flux und Reflux – A Selection of Moving Images stellt vier zeitgenössische Künstler*innen vor, die einen Bezug zu Surinam haben. Die Videoarbeiten werden jeweils für zwei Wochen online verfügbar sein:
24.06.–07.07.2021
Ansuya Blom, SPELL, 2012, 6'38
SPELL ist ein Kurzfilm, der die Gedanken eines Mannes in einem Zustand der Unwirklichkeit dokumentiert. Klänge dringen in seine Gedanken ein, werden verstärkt und vermischen sich mit Assoziationen aus seiner Vergangenheit. In dieser Zwischenwelt versucht er, wieder Halt zu finden, sinniert über frühe Anfänge und verspottet gleichzeitig seinen eigenen Zustand, die Sinnlosigkeit des Handelns und die Rituale des täglichen Daseins.


Die Bilder für diesen Film wurden im Haus von Theo Van Doesburg in Meudon, Frankreich, während einer Residenz in den Jahren 2010–2011 fotografiert. Die Worte von Franz Kafka sprechen für sich und es war ihre seltsame Mischung aus Humor und Verzweiflung, die mich angezogen hat. (Ansuya Blom)

Ansuya Blom (*1956 in Groningen) lebt in Amsterdam. Sie studierte an der Königlichen Kunstakademie in Den Haag und den Ateliers '63 in Haarlem. Blom arbeitet seit den späten 70er Jahren in verschiedenen Kunstformen, darunter Zeichnung, Malerei, Fotografie, Film, Text, Collage und Skulptur. Im Jahr 1981 erhielt sie den niederländischen Königlichen Preis für moderne Malerei. Ihre Filme wurden auf dem Internationalen Filmfestival Rotterdam, den Rencontres Internationales Paris-Berlin, dem IDFA Amsterdam und im Museum of Modern Art, New York, gezeigt. Ihre Arbeiten befinden sich in den Sammlungen von Museen, darunter das EYE Filmmuseum, Tate Modern, Stedelijk Museum und das Museum Boijmans Van Beuningen. Zu ihren Einzelausstellungen gehören das Camden Arts Centre in London, die Douglas Hyde Gallery in Dublin, das Stedelijk Museum in Amsterdam und das Casco Art Institute in Utrecht. Im Jahr 2020 wurde sie mit dem Dr. A.H. Heineken Preis für Kunst ausgezeichnet.
Blom hat außerdem einen Master-Abschluss in Psychoanalyse von der Middlesex University in London und ist assoziiertes Mitglied des Centre for Freudian Analysis and Research in London. Sie ist Beraterin an der Rijksakademie in Amsterdam und war 2019 als Gastberaterin an Kunstinstitutionen in Großbritannien, Südkorea, Surinam und Indonesien. Sie hat öffentliche Vorträge und Interviews gehalten, zuletzt an der Nola Hatterman Art Academy in Surinam, dem EYE Film Museum, dem Casco Art Institute und De Appel.
Bevorstehende Künstler*innen in der Programmreihe:
01.07.–15.07.2021
Razia Barsatie
Im Rahmen der Ausstellung Pierre Verger in Suriname lädt Willem de Rooij die Künstler*innen Razia Barsatie, Ansuya Blom, Ruben Cabenda und Xavier Robles de Medina ein, ihre Werke auf der Portikus-Website zu zeigen. Das Programm Flux und Reflux – A Selection of Moving Images stellt vier zeitgenössische Künstler*innen vor, die einen Bezug zu Surinam haben. Die Videoarbeiten werden jeweils für zwei Wochen online verfügbar sein:
10.06.2021–24.06.2021
Xavier Robles de Medina
Ai Sranang, 2017
Musik: Lieve Hugo, „Oeng Booi" und „Blaka Rosoe"
Laut dem Transnational Decolonial Institute befürwortet Dekolonialität Interkulturalität, „die Feier des Zusammenseins von Grenzbewohnern in und jenseits der Grenze“.
Ambivalenz ist das wahre Gefühl der „Diaspora" - so sehr wir es auch hassen, es zuzugeben, wir lieben das Gefühl, anerkannt zu werden, nicht als Berühmtheiten, sondern als Teil einer „Abstammung", als erweiterte Familie. Jill Casid schreibt, dass „während Diaspora seit dem neunzehnten Jahrhundert verwendet wird, um sich speziell auf die Zerstreuung eines Volkes zu beziehen, das man sich als Stamm oder Familieneinheit vorstellt, bedeutet Diaspora auch die Verstreuung von Samen".
Auch Stuart Hall hat den Begriff hinterfragt und festgestellt, dass seine Bedeutung in kolonial konstruierten Binaritäten verwurzelt ist, von „Original" und „Kopie" und von „innen" und „außen". Es ist bezeichnend, dass unsere nationale Blume, die Fajalobi, erst kürzlich aus Indien eingepflanzt wurde.
(Auszüge aus Xavier Robles de Medinas Essay „Preface")
Ai Sranang ist ein kurzer Montagefilm, der die surinamesische Geschichte und Politik seit der Unabhängigkeit von den Niederlanden im Jahr 1975 untersucht. Durch seine Fragmentierung spielt die Montage auf die Komplexität der Diaspora an, wie sie im Verhältnis zur Identität steht. Die Tropen des Dazwischen-Seins und des Reisens sind eine Erweiterung dieser Metapher, erinnern jedoch zugleich an Vorstellungen von Führung und Regierung. Das Bild eines „Swinger"-Busses, der von einem rücksichtslosen Fahrer völlig aus dem Ruder gefahren wird, erweitert seinen metaphorischen Raum über den surinamesischen Kontext hinaus auf die Ereignisse, die eine globale neoliberale Ära bestimmt haben. Xavier Robles de Medina hat eine umfangreiche Sammlung von vorgefundenen Bildern aufgebaut, die für seine künstlerische Praxis von zentraler Bedeutung ist, da er sich diese aneignet, sie bearbeitet, neu kontextualisiert und transformiert
Xavier Robles de Medina (*1990 in Paramaribo) ist ein in Berlin lebender bildender Künstler. Er machte seinen Abschluss an der Goldsmiths, University of London. 2015 wurde er für den Prix de Rome Visual Arts in den Niederlanden nominiert und stand auf der Shortlist für den Dutch Royal Award for Modern Painting. Zu seinen jüngsten Einzelausstellungen zählen SCAD Museum of Art, Savannah; Another Mobile Gallery, Bukarest; Praz-Delavallade, Los Angeles und Paris; Readytex Art Gallery. Paramaribo und Catinca Tabacaru Gallery, New York. Xavier Robles de Medina wurde ausgewählt, um an der 14. Dakar Biennale in Senegal im Jahr 2022 teilzunehmen.

Bild: Sascia Reibel
Website: http://xavierroblesdemedina.com
Bevorstehende Künstler*innen in der Programmreihe:
17.06.–01.07.2021
Ruben Cabenda
24.06.–08.07.2021
Ansuya Blom
01.07.–15.07.2021
Razia Barsatie
Für Cashmere Radio sprach Hajra Waheed mit Reece Cox über ihre Arbeit HUM, die vom 11.07. bis zum 06.09.2020 im Portikus zu sehen und hören war.
Die Folge von INFO Unltd ermöglicht, tief in Hajra Waheeds Klangarbeit HUM einzutauchen. HUM erforscht die Geschichte des akustischen Widerstands in Süd- und Westasien und Nordafrika während des letzten halben Jahrhunderts und zeigt Momente, in denen Klang und Stimme unterdrückte Völker und Bewegungen über Geografien und Generationen hinweg vereint haben.
Link zu Hajra Waheed über HUM und abolitionistische Methoden des Zuhörens
Anlässlich Arin Rungjangs Ausstellung Bengawan Solo im Portikus spricht Paula Kommoss im Interview mit dem Künstler über die Entstehung des Werkes und die Bedeutung des Flusses Bengawan Solo.
PK: What really interests me, first of all, is how did you come to find the singer for your work Bengawan Solo?
AR: A while ago, I was in Yogyakarta [in Indonesia] and had started to do research on Diponegoro, the priest to the Sultan of Yogya who is depicted in a painting by Raden Saleh. Raden Saleh was an Indonesian painter who fled from the country because of political aggression between the Dutch administration and indigenous Indonesian monarchy during the mid-19thcentury. Saleh went on to study Western painting, and his style was inspired by Delacroix, for example, which you can see in his compositions, use of lighting and so on.
Of course, all of this has been studied, and here I was wandering around in all this history about Yogyakarta and Indonesia in general, and I was also looking at the Chinese communist movement in Indonesia and so on. So, I had done all this research, and then I kept thinking about my relationship to Indonesia in general, which is always my starting point to making work. But I couldn’t find a very real connection to this material, except with the song ‘Bengawan Solo’, which I began to see would be my point of departure.
The first time I heard ‘Bengawan Solo’, I thought it was a Chinese song because I didn’t realise it hadn’t been written by the Chinese woman who sang it in 1960s. In a sense I had taken the Indonesian away in my mind. The song was really important personally because it was connected to a time in which I was questioning my sexuality, I was gay, I was not that gay, I didn't know what I was. I fell in love with a guy because of this song – it was a very romantic period for me.
I had the song in my mind for a very, very long time – stored in some part of my brain and my memory and then, even before I came to Indonesia, I discovered that the song was not by the Chinese woman after all, but that it was an Indonesian guy who wrote it in the 1940s, when he was only 19 years old. He had quit school and was working in a Kroncong band, the traditional Indonesian band that you can see in the video. And so, he created ‘Bengawan Solo’, which became incredibly popular. When Indonesia came under Japanese occupation [during the second World War], two years later, the song spread throughout Japan. There was a Dutch woman who was born in Indonesia but grew up in a Japanese internment camp, and she knew the song because it was played by the Japanese. It became stuck in her memory too, and so she sung a version of it as a teenager in the 1960s, which became really popular in Singapore and in other parts of Asia. So that was the song, and all these stories that are part of it became part of my knowledge, too.
I then got to know Rochelle – who sings this version of ‘Bengawan Solo’ – through a mutual friend. At that time, I was looking for someone who could imbue the song with more meaning beyond my own personal memories, and to share the song and its resonance with that person. So, my friend introduced me to Rochelle, a singer in a Kroncong band. Before we met, I didn’t know that Rochelle was the daughter of Lendra, a very important poet, or that her mother was a Princess, one of the daughters of the Sultan of Yogya. I was just looking for a singer who could deliver this song and share in its meanings. We met and got to know each other, and I learnt about her personal memories and history and so on, and it was so great – that there was this connection that I didn’t expect to find. I mean, I guess because things are always in circulation, things are always just there, even if it’s happening through different times. And so, the work is also about these layers of histories and memories and what we couldn’t foresee.
Actually, I didn’t need to put all that information onto the table in the show, it was just a way to display my research. For me, it’s enough to look at Rochelle singing that song and think of all these things that were happening before, before the song became so evocative for me. Like the Chinese using the river as a way to transport dead bodies during the Communist regime, and also Mushagra, Diponegoro, Raden Saleh’s painting, and all of these narratives that were in circulation through history, through art, and through memories – that’s what I think is so rich and thought-provoking.
PK: And the great thing is that all of these stories are brought together through the song ‘Bengawan Solo’, which tells the story of the legendary Solo River in Java, the island’s longest, in a really poetic way. The river is both the song’s main narrative, flowing from mountains to the sea, but also its title. So, on the one hand the lyrics lay out this seemingly simple story, but on the other, there are all these layers of narratives that you have just described: that the song comes historical connotations of the Japanese occupation, and something you mentioned earlier, that during the Communist regime, the bodies of those murdered by the state were washed by the same river. These stories are often violent but the song is beautiful, and whether you speak the language, or you don’t, a song is always a way to reach out to people.
AR: Yes, and so much spirit…
PK: …and to trigger emotion in a way.
AR: Yes, and once the work was done and shown, it was not just about me and Rochelle anymore. Like my story might be a silly one to share with the song but Rochelle’s is really rich, and also, I like to think about those people who might say “I remember this song”, and can share their own memories as well. I like what you just said about even someone who had never heard the song before, being able to access it through the narrative. So, it means that it is not just the song that evokes emotion and opens people’s hearts and feelings...
PK: Yes, and also because the song plays in a loop throughout the work, you sit there and you start reading the story as it unfolds, but the music keeps repeating over and over. As a viewer, you add all these layers on top of the music; it’s a nice way to make the song richer for everybody. And actually, I heard the song for the first time in the film In The Mood of Love (2000) but of course I didn't know anything about it then.
AR: I have used two versions of the song in my work – the version from In the Mood for Loveand the version that speaks to my experience as a gay man, which is the original recording of ‘Bengawan Solo’. Actually, [in that film] they made it into a love song. I think the film is very poignant, every time I watch it, it always gives me tears because it’s such a symbol really, about the people who lived there peacefully, and then it becomes kind of actively related with other knowledge – a cruelty of the world and colonization and so on. The land has been there for thousands and thousands of years, and on it people live and die, live and die, live and die, and they leave traces of their memories in the land and for me it’s beautiful.
PK: Yes, I think so too, and you are opening up with this really personal story, which in a way makes you vulnerable. And this is a starting point that I appreciate a lot, explaining how you discovered that you’re gay and so on, and how you become conscious of this through the romance that this song embodies for you, which adds such an emotional layer to it.
AR: And that works because I made the work specifically for Indonesia, and because if you’re gay in a Muslim country, it is very difficult, and I had a very difficult life. To share the work as an Indonesian gay Muslim was to give those feelings space, and I wanted to show the audience that they could maybe share in this level of intimacy between myself as an artist and them as the audience, through the song.
PK: You’re making it possible to expand this song, which is from Indonesia and everybody there will have their own personal connotations of it. But through opening it up and to align it with love as well is expanding the context of the song once more.
AR: It’s not only about being gay as well, I mean love as it is for all human beings…
PK: And acceptance, in a way.
AR: Like when Rochelle talks about Gusta – “Gusta is the almighty”, and Gusta doesn’t have gender – Gusta could be anything.
PK: Especially when Rochelle talks about her father, and how when he got older his ego wasn’t in the way anymore. I found that really interesting, because one could argue that when people are strongly against something, or stuck in their ways, it’s mostly because their pride is in their way. Whereas in your work ‘Bengawan Solo’, there are two narratives woven into each other and also visually, you’re surrounded by a kind of orchestra – as a viewer you feel as if you are almost facing a community.
AR: Yeah, it’s not a movie – I mean, it works in the way that we are using this type of virtual immersion to convince people, so it’s like the narrative is going on inside someone’s head.
PK: Yes, and I’m happy we get to see it here in Frankfurt. Songs are good tools to get people’s attention.
AR: It’s really that simple, yes? Because I have been working with moving image for many years and it was always different from recreating an event as a film, because it’s about how to transform it – because I always think that nothing can replace reality, and once the moment has passed and you want to go back to it, it will already have layers that weren’t there before. But I have been thinking about how to make such a recreation into something more transparent, and so for me music is about representing reality in a different way. In one sense, music is just music, but as with this song – it was created in 1940s and already had all these historical resonances, and so all these years later it is not just about the original song itself but all the layers of the spheres that the song has passed through. I think that’s enough – Bengawan Solo has its own content and to allow this content to appear in the current contemporary moment, I think this is really important.
PK: What I also like, is when you first sit down in front of the work, in a way you just read the texts. Yes, you encounter these different musicians and the singer, but for me it was kind of like going on a story ride, you know? Because as you describe the river and what happened, it’s like this storytelling moment that transforms the viewer into a child that listens and soaks everything up and from there you go on throughout the work. And somehow the story isn’t closed, which is really nice.
AR: Yeah. That’s great. I’m planning to do a new work in Berlin next year and I hope to add some other pieces.
PK: That sounds really interesting.
AR: And you know, I wasn’t quite sure about my way of making work. I mean, as a person growing up in Thailand, in that region the majority of our knowledge is not that strong, so to speak, it’s not that constructed like in Western countries. I liked conceptual work when I was young, I found it really thoughtful, but I mean we weren’t really into nature. And also, in our culture we never separate body and soul, body and spirit. A person is never separate from God. It was almost like Joseph Beuys but it was not this constructed idea. It was just in the nature of the people who lived there. It’s both a bad thing and a good thing. The bad thing was people prayed to the tree for good luck and so many outside people said that this is so Barbarian or something, but still others have attached themselves to nature, and for them they will never separate themselves from the earth, from the trees, from the river. Deep down they believe that one day they will go back to the river, to the earth, to the trees again and I have never disregarded this. I think this is how we communicate with things and a vantage point I could appreciate. I mean, not just to treat reality as a source material to reproduce in art.
PK: That adds another dimension to the river in your work, because the river is symbolic of an eternity, but I think besides it being, you know, old-fashioned to prey to a tree, it still shows a kind of respect for nature and its power when you’re surrounded by it.
AR: There’s also one poem by an Indonesian poet, which is about a person that wants to walk across the river and he is hesitating because he sees his relative’s spirit fill up that water and he cannot step into the river because of his ancestor.
PK: There is so much additional information for your work.
AR: Because the process is so complex, all the information, research, and so on. My work that was at documenta 14 246247596248914102516 … And then there were none(2017) too – that one was super rich too, so much information – this, this, this – we have tons of information…
Seit jeher gilt es als eine der wichtigsten Aufgaben der Menschen Wissen zu sichern. Dies geschieht nicht nur mithilfe mündlicher Überlieferungen an nachfolgende Generationen, sondern allem voran durch Gedächtnisinstitutionen. Unter diesem Sammelbegriff vereinigen sich all jene Einrichtungen, deren Ziel es ist, Wissen zu bewahren und zu vermitteln. Denkt man hierbei zunächst an Bibliotheken und Archive, so zählt das Museum ebenfalls dazu. Es handelt sich hierbei um Orte, die Zeitzeugnisse verwalten und gerade das zu schützen versuchen, wodurch sich die Identität einer Gesellschaft konstituiert: ihr kulturelles Erbe.
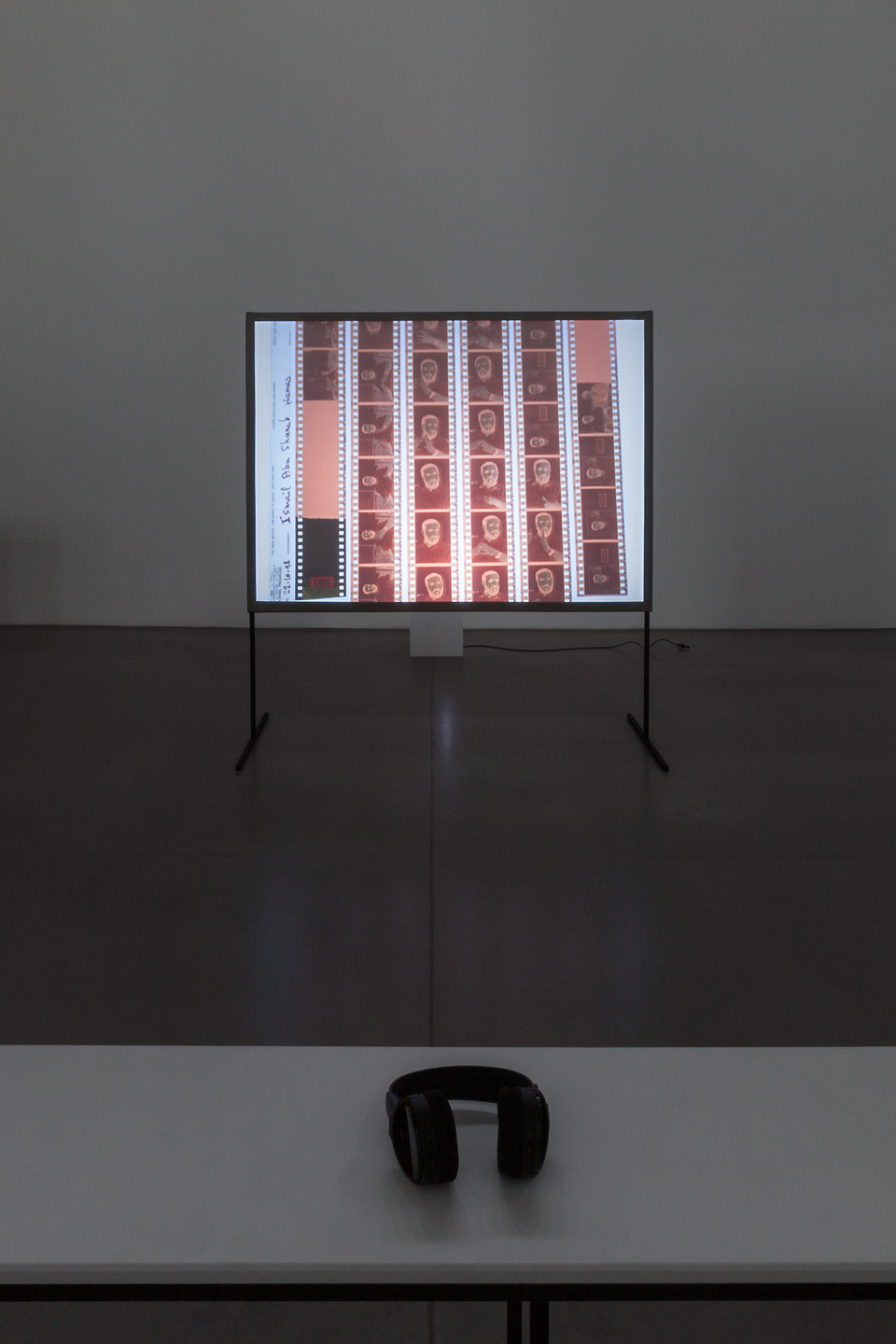
Sirah Foighel Brutman & Eitan Efrat, Printed Matter, Ausstellungansicht, Slide show, 29.04.–11.06.2017, Portikus. Foto: Helena Schlichting.
All diese Institutionen leisten ihren Anteil daran, dass wir nicht vergessen. Sie funktionieren in der Tat wie ein kollektives Gedächtnis. Doch ähnlich dem individuellen, persönlichen Gedächtnis gibt es Ereignisse, an die man gerne und stolz zurückdenkt und Begebenheiten, die unangenehm sind und deswegen in Vergessenheit geraten. Die Psychoanalyse bezeichnet diesen Prozess als Verdrängung. Während beim gewöhnlichen Vergessen unbewusst irrelevante Informationen zugunsten wichtiger gespeichert werden, werden beim Verdrängen Inhalte bewusst von der Erinnerung ausgeschlossen, um unangenehme Emotionen zu vermeiden. Die Verdrängung ist somit ein natürlicher Abwehrmechanismus, um sich selbst zu schützen. Doch was geschieht, wenn Gedächtnisinstitutionen ebenfalls von dieser Strategie Gebrauch machen? Wenn gerade jene Institutionen unbequeme Wahrheiten verdrängen, die doch als Wahrheitsgarant schlechthin gelten?
Michel Foucault nahm dem Archiv Ende der 1960er Jahre seine Unschuld. Er wies darauf hin, dass an diesem Ort keine Wahrheiten gesammelt, sondern erst konstruiert werden. Unter dem Deckmantel der Objektivität werden Tatsachen erst in solche produziert, indem jedes archivierte Dokument eine Vielzahl weiterer impliziert, die nicht in die Selektion aufgenommen worden sind. 1 Dienen Institutionen wie Archive und Museen dazu, Geschichte wie Gegenwart zu verwalten, muss sich bewusst gemacht werden, dass Machtstrukturen innerhalb dieser Institutionen letztlich dafür verantwortlich sind, welche Inhalte das Prädikat wertvoll erhalten und welche ins kulturelle Unterbewusstsein gedrängt werden. Das kulturelle Gedächtnis ist damit nicht mehr als ein Kanon.

Sirah Foighel Brutman & Eitan Efrat, Printed Matter (Still), 2011.
Wer sich in diesen einschreibt, wird nicht in Vergessenheit geraten. An ihn wird sich erinnert. Genauso wie sich Hanne Foighel an ihren Lebenspartner André Brutmann erinnert. In der Videoarbeit Printed Matter (2011) von Sirah Foighel Brutmann und Eitan Efrats werden Kontaktabzüge auf einen Leuchtkasten gelegt während eine freundliche Frauenstimme die Negative kommentiert. Das Bildmaterial stammt von dem Vater der Künstlerin, die Stimme gehört ihrer Mutter. André Brutmann war bis zu seinem Tod im Jahre 2002 ein gefragter Pressefotograf, der insbesondere den Israel-Palästina-Konflikt über Jahrzehnte mit seiner Kamera begleitete. Doch die Kontaktabzüge zeigen nicht nur Bilder von verlassenen Städten und Aufständen, sondern auch seine Familie. Brutmanns Archiv ist nicht nur des eines Fotografens, sondern auch eines Vaters. Auf der gleichen Filmrolle können sich Bilder von Staatsoberhäuptern, von Beerdigungen, aber auch von Kindergeburtstagen finden lassen. Während die Mutter der Künstlerin beim Betrachten der Familienfotos meist nostalgisch wird und Bilder von sich im Badeanzug mit einem lachenden „this doesn’t belong here at all“ kommentiert, senkt sich ihre Stimme oftmals beim Anblick der Fotografien, die Brutmann für die Öffentlichkeit gemacht hat.
Diesen Fotografien wohnt ein Unbehagen bei. Die Erinnerung an diese Momente erzeugen Stille. Die Art wie Foighel über die Bilder spricht, scheint nicht nur Auskunft über die Vergangenheit zu geben, sondern auch über die Gegenwart. Die Erinnerungen an die politischen Konflikte in den 90er Jahren scheinen sich gerade deswegen meist in Stille aufzulösen, da auch noch heute keine Lösung für diese in Sicht ist. Vielmehr scheinen die Fotografien eine historische Erzählung unserer Gegenwart zu sein, indem sie den Betrachter an Konflikte erinnern, deren Spuren noch heute sichtbar sind.
„Die Photographie sagt (zwangsläufig) nichts über das, was nicht mehr ist, sondern nur mit Sicherheit etwa über das, was gewesen ist. Beim Anblick eines Photos schlägt das Bewußtsein nicht unbedingt den nostalgischen Weg der Erinnerung ein (…), sondern den Weg der Gewissheit: das Wesen der Photographie besteht in der Bestätigung dessen, was sie wiedergibt.“2 Roland Barthes sieht in der Fotografie nur das Abbild einer bereits geschehenen Gegenwart, die nichts über ein davor oder danach aussagen kann. In gleicher Weise scheinen auch Sirah Foighel Brutmann und Eitan Efrat mit „Printed Matter“ zu argumentieren, indem sie eben nicht nur visuelles Material zeigen, sondern es auf der auditiven Ebene von einer Zeitzeugin kommentieren und reflektieren lassen. Sie schreiben somit das Archiv André Brutmanns in die Gegenwart ein, anstatt es in der Vergangenheit verharren zu lassen.
Sirah Foighel Brutman & Eitan Efrat, Printed Matter (Ausschnitt), 2011.
Doch anders als die Fotografie, ist das Gedächtnis lückenhaft. Es bleibt ein Fragment, welches sich nie zu einem Gesamtbild zusammenfügen lässt.3 Das Gedächtnis kann Daten durcheinanderbringen, Orte und Menschen miteinander verwechseln. Es kann sich nur an Bedeutsames erinnern und selbst das kann erneut in Vergessenheit geraten. Darüber hinaus kann es verdrängen. Aus diesem Grund ist es gerade das Zusammenspiel von Zeugnis und Zeuge, welches überhaupt Bedeutung generieren kann. Aus dieser Verbindung kann überhaupt das vorhergehen, was wir als Wahrheit bezeichnen und selbst dann gilt es stets diese zu überprüfen.
Die 1960er Jahre waren für die bildende Kunst in vielfältiger Weise revolutionär und wegweisend. Es verwundert daher nicht, dass die Verwendung vieler bis dato ungewöhnlicher Werkstoffe im Arbeitsprozess von Künstlern gerade in diesem Jahrzehnt ihren Ursprung oder einen enormen Aufschwung fand. Künstlerische Grenzen verschwanden bzw. wurden neu ausgelotet und Materialien wie Textilien entwickelten sich alsbald zu „autonomen künstlerischen Werkstoffen“. 1
Einer der bekanntesten Wegbereiter für diese Entwicklung ist sicherlich der deutsche Künstler Joseph Beuys, der nicht zuletzt mit einem Fokus auf die Materialien Filz und Fett internationales Renommee erwarb. Auch Beuys amerikanischer Kollege Robert Morris ist bekannt für seine Arbeiten mit Filz, obgleich sich die Intentionen der beiden Künstler hinter der Arbeit mit dem Material stark unterschieden.
Dass Textilien in der Kunst zuvor ziemlich lange eine eher marginale Rolle spielten, lässt sich aber auch aus technologischer Sicht erklären. Letzten Endes benötigte es erst einen bestimmten Maschinentypus, um großformatige Ornamente und komplizierte Textilentwürfe weben zu können. Zwar hatte Joseph-Marie Jacquard (1752 – 1834) seinen berühmten Webstuhl bereits 1801 erstmalig vorgeführt, dennoch war diese Technik lange Zeit nicht jedermann frei zugänglich oder horrend teuer und so war es auch für Künstler schwierig, bestimmte Stoffe überhaupt zu produzieren.
Jacquard-Webstühle zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass es die ersten ihrer Art waren, die auf Basis von Lochkarten webten und somit auch komplizierte Muster ermöglichen. Pro Schuss lässt sich so jeder Kettenfaden am Webstuhl einzeln oder in einer kleinen Gruppe bedienen, was bei früheren mechanischen Modellen unmöglich war. Dass diese Methodik auch heute noch eine Relevanz im künstlerischen Herstellungsprozess besitzt, zeigte die Arbeit „Acquired Nationalities“ von Rosella Biscotti in der Ausstellung „House of Commons“ im Portikus.
Jacquard Webstuhl, gefilmt im Paisley Museum (© National Museums Scotland)
Als Teil der Serie „10 x 10“ konzipiert, arbeitet Biscotti mit den demographischen Daten der belgischen Volkszählung von 2001 und dem Nationalregister (1. Januar 2006), transformiert bzw. modelliert diese mit Hilfe von programmierten Excel-Kalkulationsmodellen, um sie schließlich mit einer computergesteuerten Jacquard-Maschine auf Textil zu visualisieren. Inhaltlich interessiert sich die Künstlerin dabei vor allem für das Spannungsgefüge zwischen dem Individuum in der Gesellschaft und einer statistischen Struktur, welche zur vermeintlich objektiven Beschreibung der Selbigen in politischen Institutionen als unerlässlich gilt. Das Ergebnis ist eine hochspannende Wechselwirkung aus demographischen Daten, Ihrer Verarbeitung und einer Visualisierung in 25 verschiedenen Grautönen auf Textil.

Rossella Biscotti, Aquired Nationalities, 2014, KADIST Sammlung, Ausstellungsansicht, House of Commons, 03.12.2016–29.01.2017, Portikus, Frankfurt/Main, Foto: Helena Schlichting
Neben der Arbeit von Rosella Biscotti zeigten aber auch andere Frankfurter Ausstellungen in jüngerer Zeit Werke mit einem Fokus auf Textilien. Ein Bespiel sind die großen gewebten Bilder der Serie „weavings“ (2011 – 2014) von Willem de Rooij in der Ausstellung „Willem de Rooij. Entitled“ im Museum für Moderne Kunst - MMK 2. De Rooij lässt die Werke seit 2009 allesamt in der Handweberei „Henni Jaensch-Zeymer“ in der Nähe von Berlin produzieren. Die Maße der Arbeiten sind dabei stets direkt von den Möglichkeiten der Webstühle und ihrer Techniken abgeleitet. Der Künstler vergleicht hier die Kreuzung von Fäden, die in zwei verschiedene Richtungen laufen, mit Begriffen wie Opposition, Kontrast, Übergang und Nuance. Manche der daraus entstehenden Gewebe erinnern zunächst stark an monochrome Malereien, bei genauerer Betrachtung offenbaren jedoch auch die vermeintlich einfarbigen Gewebe mindestens zwei Farbnuancen.

Willem de Rooij, Taping Precognitive Tribes, 2012 , Courtesy: Friedrich Christian Flick, Foto: Axel Schnider, Quelle: Mousse Magazine)
Ebenso beschäftigt sich der in Frankfurt lebende und arbeitende Künstler Thomas Bayrle mit Textilien, genau genommen mit ornamentalen Bildern und dem Prinzip des Seriellen. Mit einem Augenmerk auf Motive aus der Popkultur interessiert sich Bayrle, der einst selbst eine Ausbildung zum Weber absolvierte, vor allem für „das Verhältnis vom einzelnen Faden zum Gesamtstoff“2 und vergleicht dieses Gefüge mit der Beziehung des menschlichen Individuums mit dem Kollektiv bzw. der Gesellschaft. Ferner bewies der Künstler aber auch schon sein Können in der angewandten Kunst, wie es beispielsweise seine Entwürfe für das weltberühmte Modelabel „Clemens en August“ zeigen, welche 2008 auch im Zuge einer ihm gewidmeten Retrospektive in der Galerie Francesca Pia zu sehen waren.

Thomas Bayrle, All-in-One, Ausstellungsansicht, WIELS Contemporary Art Centre, 09.02 – 12.05.2013, Brüssel, 2013. Quelle: WIELS
Es zeigt sich, dass textile Arbeiten weder oberflächlich sind, wie es eine Assoziation mit der Modewelt vielleicht suggerieren könnte, noch eine profane Handwerkskunst darstellen. Vielmehr beweist nicht zuletzt schon die Komplexität der verschiedenen Materialien, dass Textil ein ideales Medium ist, um sowohl individuelle Geschichten als auch gesellschaftliche Zusammenhänge zu beschreiben oder beiden Themen sogar zu verweben.
Acht Vierkant-Aluminiumstäbe unterschiedlicher Längen lehnen in regelmäßigen Abständen an der weißen Wand des Portikus. Die glatt polierte Oberfläche reflektiert das Licht und die Umgebung und hüllt sie in ein silbrig-weißes Schimmern. Auf jeweils einer Längsseite der Stäbe ist in schwarzen, serifenlosen Großbuchstaben aus Kunststoff ein Vers des Gedichtes There is a Solitude of Space, Nr. 1695, von Emily Dickinson zu lesen:
THERE IS A SOLITUDE OF SPACE
A SOLITUDE OF SEA
A SOLITUDE OF DEATH, BUT THESE
SOCIETY SHALL BE
COMPARED WITH THAT PROFOUNDER SITE
THAT POLAR PRIVACY
A SOUL ADMITTED TO ITSELF–
FINITE INFINITY 1
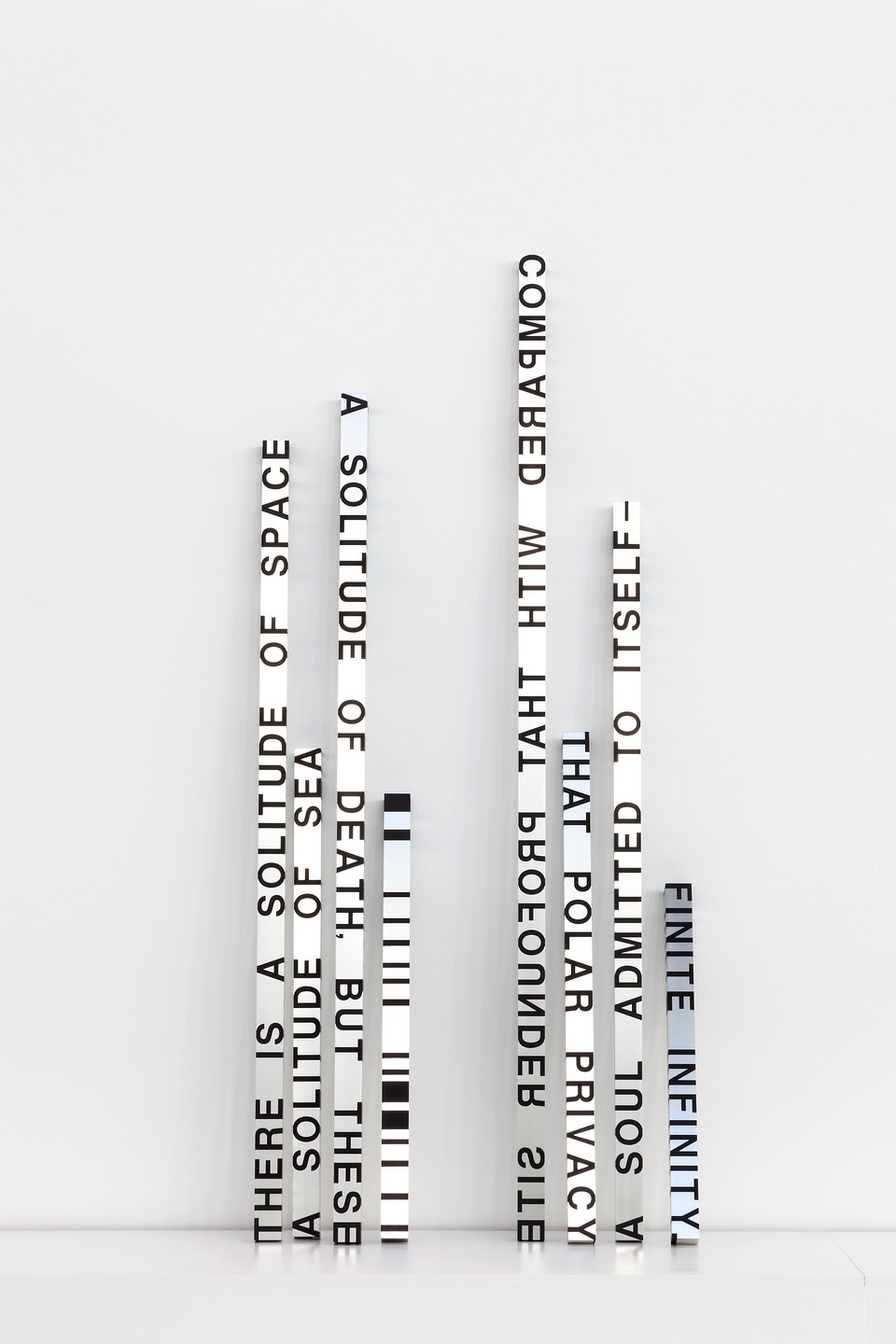
Roni Horn, When Dickinson Shut Her Eyes: No. 1695 (There is a Solitude of Space), 1993, Ausstellungsansicht, House of Commons, 03.12.2016–29.01.2017, Portikus, Frankfurt/Main, Foto: Helena Schlichting.
Die Worte der Dichterin aus dem 19. Jahrhundert, die sich bereits als Jugendliche in das Haus ihrer Eltern in Amherst, Massachusetts in den Vereinigten Staaten, zurückzog und unter erimitischer Lebensführung 1775 Gedichte verfasste, sind von der Künstlerin Roni Horn in die Vertikale getrieben und klingen bescheiden in den Ausstellungsraum hinein. Unter dem Titel When Dickinson Shut Her Eyes entwickelte die Künstlerin in den 1990er Jahren eine Reihe von skulpturalen Arbeiten, die einen unmittelbaren Bezug zu dem poetischen Werk Emily Dickinsons aufweisen, ihre Gedichte verkörpern und neu „aufführen“. Die Arbeiten stellen den Austausch zwischen Sprache, Objekt und Betrachter zur Debatte und fördern in ihrer ruhigen, gleichförmigen Erscheinung die Erweiterung festgelegter Denkmuster.
Roni Horns industriell gefertigte Aluminiumstäbe verzahnen auf vielfache Weise Text und Objekt. Sie reihen sich aneinander wie aus einem Buch ausgeschnittene Verszeilen. Die metallenen Oberflächen reflektieren vor allem die oberen Wand- und Deckensegmente des Portikus, wodurch sie die weiße Farbgebung eines Papieruntergrundes annehmen. Dort, wo die Buchstaben die Kanten berühren, werden sie als Markierungen weitergeführt. So umschließen sie den Schaft des Stabes und vermitteln das Bild aufgeblasener Lettern aus tief eingesogener Schreibtinte. Das zweidimensionale Medium der Schrift legt sich um den dreidimensionalen Körper der einzelnen Skulpturen. Damit changiert die Arbeit von Roni Horn zwischen zwei Verhältnissen der Text-Objekt-Beziehung: Zum einen bestimmen die Längen der Verszeilen den exakten Zuschnitt der Objekte und die mehransichtigen Schriftzeichen etablieren sich von ihrem Untergrund. Zum anderen werden sie wegen der formellen Korrelation an den Träger gebunden und von diesem gerahmt.

Roni Horn, When Dickinson Shut Her Eyes: No. 1695 (There is a Solitude of Space), 1993, Ausstellungsansicht, House of Commons, 03.12.2016–29.01.2017, Portikus, Frankfurt/Main, Foto: Helena Schlichting.
Jeder Stab gilt dabei gleichermaßen als in sich geschlossenes und abgeschlossenes Objekt. Neugierde wird durch einen der mittleren Stäbe erzeugt: Dieser ist in einer Weise verstellt, dass die beschriftete Seite in den Zwischenraum der Objekte gedreht ist. Die Zeile „SOCIETY SHALL BE“ ist aus der Frontalansicht nicht mehr entzifferbar. Da an dieser Stelle die kommunikative Funktion von Schrift zugunsten ihrer grafischen Qualitäten aufgelöst wird, ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen Objekthaftigkeit und Textualität. Die Lücken werden zu assoziativen Freiräumen. Sie öffnen den Blick auf die dahinterliegende, weiße Wand und ermöglichen, analog dem Lesen zwischen Zeilen, die Suche nach weiteren Deutungsebenen.
Durch die Charakteristik des zum Gegenstand gewordenen Textes werden wir als Betrachter auf besondere Weise herausgefordert. Leserichtung und Verlauf der Buchstaben sind stets vertikal ausgerichtet, so dass die Stäbe Glieder einer literarisch-poetischen Kette ergeben. Einer Reihung von Sätzen, deren Syntax durch die verschiedenartige Ausrichtung des Textes gestört wird. Wir sind dazu angehalten, unter stetigem Perspektivwechsel zu lesen: Mal von unten nach oben, mal umgedreht, mal spiegelverkehrt. Dadurch bricht die Arbeit mit dem gewohnten, statischen Leseverhalten. Um die Sätze in ihrer Vollständigkeit zu erfassen, wird der eigene Körper in die Bewegung gezwungen. Uneinigkeit entsteht zwischen Distanz und Nähe: Einerseits passen wir uns beim Lesen körperlich den Schriftverläufen an, zugleich aber verfremdet diese spezielle Interaktion unseren Lesefluss.
Roni Horn materialisiert die Worte Emily Dickinsons und macht sie physisch erlebbar. Sie konfrontiert uns mit einer statischen Körperlichkeit, die unsere Bewegung einfordert. Im stillen Abschreiten der Objekte formen sich die Sätze gedanklich zu einem Ganzen und ergeben die Projektionsfläche für vielfältige Lektüren und Sichtweisen auf die Arbeit. Stillstand und Bewegung, Sprache und Form fließen zu einer räumlichen und zeitlichen Erfahrung zusammen, innerhalb derer sich die genannten Einheiten auflösen. Die Künstlerin schafft somit eine Situation, in der assoziatives Gedankenspiel und körperliche Regung in Verbindung treten.
Haut bedeckt die Oberfläche des menschlichen Körpers. Sie staucht oder dehnt sich mit seinen Bewegungen und trägt die Spuren seiner Handlungen und Blessuren. Gegenstände, die sich an die Haut schmiegen, vom Körper benutzt oder getragen werden, beeinflussen seine Haltung wie auch seine Bewegungsabläufe und passen sich an sie an (oder werden daran angepasst). Kleidung, Schuhe, Möbel und Prothesen ergänzen den Körper um Form und Funktion. Sie verleihen ihm Fähigkeiten, die er von sich aus nur begrenzt besitzt und ermöglichen ihm so zum Beispiel in der Kälte nicht zu frieren, vom Boden erhoben zu sitzen oder mit nur einem Bein zu gehen. Auch wenn sie gerade nicht in Benutzung sind, werden an den jeweiligen Gegenständen die Spuren ihres Gebrauchs und damit die Abbilder ihrer Träger sichtbar.
Der Sockel ist ein Körper im Raum. Trägt er im künstlerischen Ausstellungskontext einen Gegenstand, so ist dies eine Setzung, die Dritte (Künstler/Kuratoren) initiiert haben. Diese Setzung besteht für die Dauer ihrer Präsentation. Sie provoziert den Kontakt zweier Körper, dem Tragenden und dem Getragenen. Der Sockel erweitert das zu tragende Objekt um mehrere Funktionen: Er trennt den Gegenstand von seinem Umraum und erhebt ihn; der Boden, auf dem der Betrachter steht, ist so nicht mehr der Boden, auf dem das Objekt steht, sondern provoziert eine Distanz, welche die Wahrnehmung seiner Oberfläche in den Vordergrund rückt. Diese Distanzierung erhebt das Objekt faktisch, aber auch ideell. Dinge, die auf ihre Betrachtung reduziert sind, werden (meist) unantastbar und gehören nicht mehr zur Welt der Gebrauchsgegenstände.

Edgar Degas, Petite danseuse de quatorze ans, 1878/1881, by M.T. Abraham Center - Provided by copyright owner of both photograph and artwork, CC BY 3.0, Wikimedia Commons
Wie präsent der Sockel innerhalb einer Präsentation sein darf, hängt davon ab, wie geschlossen das Kunstwerk ist, das er trägt, das heißt, wie sehr es sich aufgrund seiner Beschaffenheit von seinem Umraum abgrenzt. Ist die formale Präsenz von Objekt und Sockel gleichermaßen stark, so wird der Sockel zu einem Teil des Kunstwerks.

Michelangelo Pistoletto, Vetrina-Specchio, 1966
Es gibt jedoch künstlerische Objekte, die nicht auf einem Sockel stehen und trotzdem die nötige Distanzierung zum Betrachter produzieren, um als unantastbare Kunstwerke wahrgenommen zu werden. Kunstwerke, denen dies aufgrund ihrer eigenen Konstitution gelingt, wird eine höhere Autonomie zugesprochen als solchen, die auf Sockeln stehen. Steht ihre Oberfläche in direktem Kontakt mit dem Boden, den sie mit dem Betrachter teilen, benötigen sie keine Unterstützung.

John McCracken, Minnesota, 1989
Der Körper des Sockels kann unterschiedlich in Erscheinung treten. Er wird unsichtbarer, je „normaler“ er ist, das heißt je mehr seine Form seiner Funktion als bescheidener Träger entspricht. Je weiter er von dieser subjektiv empfundenen Norm abweicht, desto präsenter wird er. Die Faktoren, die hier eine Rolle spielen, sind seine Proportion, Form, Materialität und Oberfläche. Trägt ein Sockel kein Objekt, so wird seine Oberfläche zur Projektionsfläche. Je mehr er sich in den genannten Faktoren von dem entfernt, was man als Sockel wahrzunehmen gewohnt ist, desto mehr wird er zur autonomen Skulptur. Er durchläuft einen Wandel vom Gebrauchsgegenstand zum Gegenstand der Betrachtung. Die Übergänge sind fließend. Sie reichen von einer Art Phantomschmerz, der das Fehlen eines Objektes auf dem Sockel so präsent macht, dass dessen Abbild fast greifbar wird, bis hin zu einer formalen Sättigung durch die Erscheinung des Sockels selbst.

Shahryar Nashat, Chômage Technique (A,B,C,D,F,G,H), 2016
Die Arbeit Chômage Technique von Shahryar Nashat besteht aus rosa bemalten Sockeln, die sich auf stuhlähnlichen Gestellen im pinken Licht des Portikus zu sonnen scheinen. Ihnen gegenüber steht Nashats Video Present Sore, das in kurzen, intensiven Sequenzen Körper in Aktion und in starrer Pose zeigt. Die Kamera fährt über makellose oder verletzte Hautoberflächen und fokussiert deren Kontaktstellen mit Kleidung, Bandagen und Prothesen. Im weiteren Verlauf des Videos tastet sie sich heran an ein Meat Piece von Paul Thek, aus dem Kabel und Schläuche ragen, und wird unterbrochen vom Rendering eines rosa befleckten Hinkelsteins, das sich immer wieder ins Bild setzt, um schließlich darin zu verharren. Entspannt können die kleinen Sockel das Treiben der Dinge betrachten, denn sie sind von ihrer Funktion freigestellt und müssen von all dem nichts mehr tragen.
Zur Ausstellung von Shahryar Nashat
Marina Rüdiger, MA Bildende Kunst & BA Kunstgeschichte (Kunsthochschule Kassel), studiert momentan im Studiengang Curatorial Studies, einem Master Programm an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – Städelschule und der Goethe Universität Frankfurt. Nebenbei arbeitet Sie für die Galerie Bärbel Grässlin.

Spotting the Shottspotter: Foto eines Shotspotter Mikrofons, installiert an einer Strassenlaterne. Courtesy der Künstler.
Im Dezember 2014 tauchten neue Audio-Beweise auf, die den Augenblick festhalten, als der unbewaffnete Teenager Michael Brown im August desselben Jahres in Ferguson, Missouri, erschossen wurde. Die Aufnahme wurde von einem ungenannten Mann vorgelegt, der den Moment der Erschießung zufällig festgehalten hatte, als er mit der App Glide eine private Sprachnachricht aufnahm und verschickte. Erst später erkannte er die Bedeutung dieser zufällig aufgenommenen Schüsse.
In dem Mitschnitt ist zu hören, dass Browns Mörder, ein Polizeibeamter namens Darren Wilson, seine Waffe zehn Mal abfeuerte. Sechs dieser Schüsse trafen Brown, die meisten davon in den Kopf (alle oberhalb des Oberkörpers). Doch die Aufnahme hält auch eine andere, unvermutete Form der Gewalt fest – die die Zuhörer, seien es CNN-Zuschauer oder das Schwurgericht, zu ignorieren gebeten wurden. Während sowohl die Verteidigung wie die Anklage Audiosachverständige beauftragten, ihre jeweiligen Erkenntnisse über die Schüsse mitzuteilen, die im Hintergrund dieses Mitschnitts zu hören waren, erkannte keiner der beiden, dass die größere Polizeigewalt, die sich gegen die Bewohner von Ferguson und vieler anderer afroamerikanischer Viertel in den Vereinigten Staaten richtet, im Vordergrund und für alle deutlich zu hören war.
Das Folgende ist eine Transkription des Mitschnitts einschließlich der Vorder- und Hintergrundgeräusche:
„You are pretty. [6 Schüsse] You’re so fine. Just going over some of your videos. [Schuss] H[Schuss]ow c[Schuss]an I f[Schuss]orget?“
Dr. Robert Showen war einer der zentralen sachverständigen Hörer in diesem Fall. Seine Analyse der Schüsse konzentrierte sich vor allem auf den Widerhall, den sie erzeugten. Mittels des Impulsschalls der Schüsse und deren Reflexionen von den umliegenden Wänden konnte er den Raum um den Schützen herum definieren. Die klangliche Ähnlichkeit der einzelnen Schussechos ließ den Schluss zu, dass der Mörder sich nicht bewegte und bei der Abgabe der Schüsse mehr oder weniger am selben Ort verblieb. Diese Indizien stützten einige der Zeugenaussagen und waren außerdem von entscheidender Bedeutung, um den Wahrheitsgehalt anderer widersprechender Aussagen zu bestreiten. Technische Details, die sich letztlich zu einer umfangreicheren Beweislage verdichteten, welche darauf schließen ließ, dass der unbewaffnete Michael Brown den Beamten angegriffen hatte, der daher in Notwehr handelte, als er Brown mehrfach in den Kopf schoss.
Die Berufung von Dr. Robert Showen als Gutachter erfolgte aufgrund seiner umfangreichen praktischen Erfahrungen mit dem Schall von Schüssen zur Echoortung. Showen ist der Gründer und Entwickler von ShotSpotter™, einem System zur Detektion und Ortung von Schüssen, das mithilfe von Mikrofonen funktioniert, die über ein ganzes Viertel verteilt installiert werden und auf Geräusche von der Straße lauschen, bei denen es sich um Schüsse handeln könnte. Sobald die Mikrofone einen lauten Knall registrieren, bestimmen sie durch Triangulation automatisch seinen Herkunftsort. Auf Grundlage einer umfangreichen Datenbank mit lauten Knallgeräuschen werden die Daten algorithmisch analysiert, um unverzüglich festzustellen, ob es sich bei dem registrierten Geräusch tatsächlich um einen Schuss handelt. Wenn das System entsprechend entscheidet, sendet es die Ortsangabe des Schusses an die jeweilige Polizeidienststelle. Die Genauigkeit beträgt durchschnittlich 10 Meter. Das ShotSpotter™-System von Mikrofonen ist heute in achtzig „Problem“-Vierteln überall in den Vereinigten Staaten installiert. Das Unternehmen ist bestrebt, auch jenseits des Atlantik tätig zu werden, hat bereits Systeme in Südafrika installiert und erkannte nach den jüngsten Angriffen in Paris (im November 2015) die Gelegenheit für sich, den europäischen Markt zu erobern.
Dr. Robert Showen erklärte mir einem Interview, dass die ShotSpotter™-Mikrofone üblicherweise auf Gebäudedächern installiert werden, sodass man „dem Horizont zuhören“ könne. „Sie befinden sich also meistens auf Privatgrundstücken?“, fragte ich. Seine Antwort lautete: „Ja, wir waren gemeinsam mit der Polizei unterwegs, haben an Türen geklopft und die Bewohner um ihre Erlaubnis gebeten, an ihrem Haus einen Sensor anzubringen, um einen Beitrag zum Schutz der Gemeinschaft vor Schüssen zu leisten, und beinahe jeder willigte ein. […] Alle waren bereit, im Interesse der Gemeinschaft ihre Dächer zur Verfügung zu stellen.“ Showens Aussage, dass „alle bereit waren“, schien im Widerspruch zu der ganzen Rhetorik des ShotSpotter™-Systems zu stehen, dessen Notwendigkeit als Sicherheitsinfrastruktur damit begründet wird, dass die von Waffenkriminalität betroffenen Gemeinschaften aus unzuverlässigen Zeugen bestehen, die über achtzig Prozent der wahrgenommenen Schüsse nicht melden. Dem Konzept zufolge soll ShotSpotter™ diese unaufrichtigen Ohren also durch gesetzestreue Mikrofone ersetzen und die achtzig Prozent der zuvor nicht gemeldeten Schüsse algorithmisch erfassen. Showen sagt: „Die Empfindlichkeit der Mikrofone unserer Sensoren entspricht beinahe der eines Mobiltelefons oder einer Freisprecheinrichtung.“ Doch im Allgemeinen ist das menschliche Gehör viel empfindlicher und viel besser für die Interpretation von Geräuschen geeignet als das auf einem Dach installierte Mikrofon eines Mobiltelefons. Das Problem ist also nicht, dass die Menschen die Schüsse im Gegensatz zu den Mikrofonen nicht hören würden, sondern vielmehr, dass die Menschen die Schüsse hören und sich dann dagegen entscheiden, sie der Polizei zu melden. Diese erstaunlich hohe Zahl nicht gemeldeter Vorfälle legt nahe, dass die Polizei, wie im Fall von Michael Brown und Hunderten anderer seither, gefährlicher, rassistischer und schießwütiger sein kann als die Alternative. Auf diesen Gedanken scheint Showen nicht zu kommen, wenn er über die brutale Einweihungszeremonie berichtet, die in jedem Viertel im Zuge der Installation von ShotSpotter™ stattfindet: „Wenn wir ein System installieren, lassen wir die Polizei durch die Straßen ziehen und Schüsse abgeben, und wir können dann sehen, mit welcher Exaktheit und Empfindlichkeit unser System arbeitet.“
Es ist keine Überraschung, dass Showen beim kriminaltechnischen Anhören des Mitschnitts von Michael Browns Tod den lautesten Aspekt überhört: die liebestrunkene Stimme, die trotz des Klangs der Schüsse, die laut vor dem Fenster erschallen, unbeeindruckt damit fortfährt, eine Botschaft an das Objekt seiner Begierde zu senden. Ohne wahrzunehmen oder vielleicht ohne sich darum zu bekümmern, dass die Liebesbotschaft, die er verschickt, von den Klängen brutaler Gewalt untermalt wird. „Du bist wunderschön“, sagt er, und darauf folgt eine kurze Pause, lang genug für eine Salve von sechs Schüssen, dann eine kurze Unterbrechung der Schüsse, und er fährt fort mit: „Du bist so zart.“ Bedeutet diese kurze Pause, dass er die Schüsse zur Kenntnis nimmt? Wartet er darauf, dass sie verstummen, damit er mit seiner Botschaft fortfahren kann? Vielleicht wie die Pause, die wir bei einer Unterhaltung machen würden, wenn ein Flugzeug über unsere Köpfe hinwegfliegt? Oder handelt es sich bei dieser Pause um bloßen Zufall, und er ist einfach völlig unempfindlich gegenüber dem Klang von Schüssen vor seinem Fenster geworden? Auf jeden Fall wird diese Stimme, die diesen sehr lauten Klang ignoriert, anstatt die Notfalldienste zu alarmieren, im Gerichtssaal als irrelevant behandelt. Doch ironischerweise bietet gerade diese Stimme, die die Geschworenen nicht beachten sollten, die beste Möglichkeit, um das Ausmaß der Gewalt in diesen Vierteln und das allgemeine Misstrauen gegenüber der Polizei zu verstehen.
Future, March Madness [prod by Tarantino], von dem mixtape 56 Nights 2015.
Häufig wird die Besorgnis geäußert, ShotSpotter™ könne eine Verletzung des vierten Zusatzartikels zur Verfassung darstelle – als willkürliche Fahndung nach und Festsetzung von öffentlichen Klängen. Eine tief in den Alltag eindringende Überwachungsmethode, die dazu genutzt werden könnte, um private Gespräche aufzunehmen und so ein gewaltiges Tonarchiv zusammenzutragen, das allen möglichen Sicherheitsanwendungen zur Verfügung stünde. Doch die Datenschutzrichtlinie von ShotSpotter™ besagt: „Das System ist bewusst so gestaltet, dass es ‚Zuhören in Echtzeit‘ nicht erlaubt. Die Sensoren von ShotSpotter werden nicht durch menschliche Stimmen ausgelöst.“ Und vielleicht ist dies die beängstigendere Möglichkeit: dass sie sich für menschliche Stimmen überhaupt nicht interessieren. Dass ShotSpotter™ nicht auf eine neue über-überwachte Gesellschaft verweist, in der alles mitgehört wird, was wir sagen, sondern vielmehr auf eine Gesellschaft, in der ein völliger Mangel an Zuhören herrscht. Dass je mehr die Überwachung ihre Tonarchive und Audiodatenbanken vergrößert, desto weniger Menschen tatsächlich gehört werden. Und wenn wir der Stimme in dem Mitschnitt des Mordes an Michael Brown zuhören statt an ihr vorbei, wird das Ausmaß dieser gesellschaftlichen Taubheit deutlich hörbar – eine Taubheit von Gemeinschaften gegenüber Waffengewalt, eine Taubheit der Polizei gegenüber sogenannten „Problem“-Vierteln und eine Taubheit der Richter und Gesetzgeber gegenüber den sozialen Bedingungen, die unzuverlässige und uninteressierte Zeugen hervorbringen.
Die Analyse der Schüsse, die Michael Brown getötet haben, hat nicht zu seinen Gunsten gewirkt, weil die Bedingungen des Zuhörens durch dieselben Mächte bestimmt werden, die die Ungerechtigkeit gegen ihn verübt haben. Doch was könnte uns ein Shotspotter ermöglichen, dessen Mikrofone sich gegen die Polizei richteten statt gegen die Menschen? Die Technik ist vorhanden, sie wurde bereits installiert, bevor wir davon Kenntnis hatten, und obwohl sie in achtzig Vierteln jeden einzelnen Schuss aufgenommen hat, gab es keinen einzigen Fall, in dem sie als Beweismittel für die strafrechtliche Verfolgung eines Polizisten genutzt worden wäre. Wie würde es klingen, wenn wir diese riesige Datenbank von Polizeischüssen anhören könnten, statt sie nur in den unempfindlich gemachten und terrorisierten Gemeinschaften erschallen zu lassen, in denen sie so häufig vorkommen. Anstatt die Wahrung unserer Privatsphäre zu verlangen und diese Technik abzulehnen, sollten wir vielmehr verlangen, dass mehr zugehört wird, dass mehr archiviert wird, um ihre selektiven Ohren gegen sie selbst zu verwenden. Eine alternative Audiodatenbank aufbauen, aus der dieses System eine künstliche Intelligenz gegenüber einer anderen Realität der Gewalt entwickeln kann.
Zuerst online gestellt am 12. Februar 2016, L’internationale online.
Übersetzung: Robert Schlicht
Bevor ruangrupa den Verlag consonni einlud, einige der wichtigsten Publikationen der documenta fünfzehn zu produzieren, hatte dieser in Bilbao ansässige Verlag (die Begriffe Kollektiv, Kooperative und Agentur würden gleichermaßen auf ihn zutreffen) bereits seit fast drei Jahrzehnten eine vielseitige Praxis entwickelt, die sich in einer Vielzahl von Aktionen und Medien niederschlägt und einen bedeutenden Raum in der Verbreitung kritischer Kultur im spanischsprachigen Raum definiert. Die Veröffentlichung von lumbung stories in acht Sprachen, darunter Arabisch, Bahasa Indonesisch, Baskisch, Deutsch, Portugiesisch und Spanisch, zusätzlich zum Englischen, verdeutlicht das tiefe Engagement von consonni für emanzipatorische Differenz, Transnationalismus, Gastfreundschaft und Dekolonialität – Schlüsselaspekte ihrer fluiden Agenda. Dieses Gespräch zwischen der Mitbegründerin von consonni, María Mur Deán, und Manuel Cirauqui, Ko-Kurator von HOW(EVER) RADICAL OBJECTS, ist ein Vorgeschmack auf das Symposium, das vom 20. bis 23. Oktober im Portikus stattfinden wird.
Manuel Cirauqui: Bei consonni geht ihr das Publizieren sehr breit an, man könnte sagen, ihr macht es auf eine transversale und kämpferische Weise. Dennoch lädt eure Arbeit dazu ein, das Buch als Ufer zu betrachten, als Nahtstelle zwischen den Praktiken: ein Zugangspunkt, der es einer Vielzahl von Menschen ermöglicht, bestimmte Grenzen zu überschreiten und neue Räume für theoretische und praktische Vorstellungen zu erschließen. In seinen ermöglichenden Bewegungen und Zugängen ist das Buch immer noch ein Vehikel von einzigartiger Kraft. Wie hat sich dein Verständnis des Buches und der redaktionellen Produktion entwickelt, um consonni zu dem Referenzpunkt zu machen, an dem es heute in der kritischen Kultur steht?
María Mur Deán: consonni ist, wie du weißt, eine mutierte Kreatur, deren Superkräfte Feminismus und Zuhören sind. Das Zuhören in unserer engsten Gemeinschaft ist für die Entwicklung von consonni von grundlegender Bedeutung. In den späten 90er Jahren fungierte es als Zentrum für zeitgenössische künstlerische Praktiken in Bilbao, als es das Guggenheim-Museum noch gar nicht gab. Die Bedürfnisse des künstlerischen Kontextes waren sehr konkret, und es gab nicht so viele Räume für ihre Präsentation. Als die Produktion zu einer Notwendigkeit wurde, in einem Kontext, in dem der Begriff des Einzelkünstlers, der in seinem Atelier arbeitete, obsolet wurde, entwickelte sich consonni zu einem künstlerischen Produzenten. Die redaktionelle Produktion wurde eng mit der künstlerischen Produktion verknüpft, und unsere ersten Bücher waren Kataloge mit den von uns produzierten Projekten. Allmählich wollten wir uns von der Selbstreferenzialität lösen und entdeckten nach und nach die Macht des Verlagswesens, die kritische Kultur zu verbreiten. Wichtig ist, dass wir mit Künstler*innen und professionellen Autor*innen zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie wir unser gemeinsames Projekt am besten verwirklichen können. Bei vielen Gelegenheiten haben wir darüber gesprochen, dass die Nachfrage des Marktes in der Welt der Kunst als etwas Verdächtiges erscheint, aber in der Welt des Buches haben die fernen Horizonte, die die Literatur erreichen kann, etwas Befreiendes; das Gefühl, einem Ruf zu folgen. Der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden, in der Mitte zwischen den künstlerischen Sprachen, dieser transdisziplinäre Ort, ist mächtig. In dieser Bresche entsteht ein ermächtigender Dialog, der es uns ermöglicht, uns auf Reisen zu begeben, die über die Themen und Stereotypen einer dieser beiden Welten hinausgehen. Ein solcher Zwischenraum ermöglicht es uns, über beide Disziplinen hinauszugehen. Es geht nicht darum, Bücher zu bearbeiten und zu veröffentlichen, die von niemandem gelesen werden, sondern darum, uns in eine Buchwelt einzuführen, die von ihren Leser*innen getragen wird. Und dabei geht es nicht darum, der Kunstwelt zu entfliehen, sondern genau das Gegenteil. Unsere literarische Arbeit ist in gewisser Weise ein künstlerisches Projekt in seiner Gesamtheit, während die künstlerische Produktion, wie jede Erfahrung, eine Erzählung und nichts anderes als eine Erzählung ist.
MC: In einigen Gesprächen habt ihr die Idee einer gemeinsamen Verantwortung von Leser*innen und Autor*inen erwähnt, nämlich die der "Verkörperung von Diskursen". Ich finde das eine schöne Art und Weise, die Anstrengungen, die Suche und die Mühen eines Verlagsprojekts zu erklären, aber mir scheint, dass damit auch etwas betont wird, was man vielleicht aus Feierlichkeit oder Formalismus zu übersehen geneigt ist, nämlich die Performativität des Buches: das, was es zu einem tragbaren Objekt und zu einem öffentlichen Raum an sich macht, zu einem Ort der Aktivierung. Während HOW(EVER) hoffen wir, diese Ebene des Lesens als eine Aktivität anzusprechen, die uns einbezieht und unsere Körper umarmt. Es scheint, dass diese performative Konzeption des Buches im lumbung ein ideales Modell zur Erforschung gefunden hat.
MM: Ja, ein Buch ist tatsächlich ein kollektives Projekt, ein Projekt der Aktion und der Aktivierung. Es ist ein Artefakt und es ist manchmal explosiv. Gleichzeitig ist es von grundlegender Bedeutung, die romantische Aufladung des Buches zu beseitigen und seiner Fetischisierung zu entkommen. Cristina Rivera Garza betrachtet das Schreiben als ein Umschreiben, als eine unvollendete Übung, die ein gemeinsames Sein, eine Gemeinschaftlichkeit hervorbringt. Wichtiger als der Inhalt oder die Botschaft ist der Prozess des Teilens, der das Denken begleitet. Unsere Beziehung zur Literatur geht durch die Idee der Gemeinschaft, wie Jean-Luc Nancy feststellte – so wie die Produktion unter unserem eigenen Blickwinkel durch den Benjamin'schen Begriff der Enthüllung des Produktionsapparates und dem Versuch, ihn zu transformieren, geht. Die Begriffe lumbung, Tequio, Auzolan haben es uns ermöglicht, uns schneller in diese Richtung zu bewegen. Wir haben Worte mobilisiert, um die Grenzen des Sagbaren durch Literatur und durch unsere Verkörperung dieser Worte aufzuzeigen. Wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten mit der Choreografin Idoia Zabaleta zusammengearbeitet, um Buchlesungen zu entwickeln, insbesondere von lumbung stories, dieser Anthologie von Erzählungen über Kollektivität, die wir im Rahmen der documenta fifteen koordiniert haben. Lesen tanzen. Tanzend lesen. Der Körper interpretiert die Geschichten, der Rhythmus passt sich den Botschaften und dem Ton an. Die Worte verkörpern die Körper und das Publikum liest die Kurven, die Risse. Einmal mehr intervenieren wir mit der Kunst in die Literatur. Die documenta fifteen durch Fiktion zu erreichen, zeigt die mächtige Fähigkeit von Literatur und Fiktion, Gemeinschaftlichkeit zu erzeugen und aufzuführen.
MC: Werden und Transformation sind der Schlüssel zum Verständnis der Praxis von consonni. Du hast es als "mutierende Kreatur" bezeichnet – fast wie eine Figur in einer der Fiktionen, die ihr selbst veröffentlichen könnten – und als "interdependentes Verlagshaus". Er ist gleichzeitig eine Plattform, eine Agentur, ein Produktionsbüro, ein Schwarm von Wünschen. Glaubst du, dass ihr euch auf einem Weg der Konsolidierung eurer Methoden und eures Programms befindet, oder verspürt ihr eher das Bedürfnis nach einer systematischen Mutation oder einem Nomadentum, einer Form des Widerstands gegen die Identität selbst? Es gibt beschwörende Worte, vom Transformismus bis zur Tiermimikry und der Kunst der Flucht, die vielleicht mit eurem derzeitigen Geisteszustand übereinstimmen. Ich denke dabei an harriet c. brown, euer jüngstes kollektives Pseudonym.
MM: Du hast Recht, dass die Mutation zu einer Konstante geworden ist. Und das scheint unvermeidlich zu sein, denn consonni ist auch ein vielköpfiges Wesen, eine Offenbarung der verschiedenen Körper und Köpfe derjenigen von uns, die es verkörpern. Es antwortet auf die verschiedenen Kontexte und Zeiten, in denen es atmet. Jede Person, jedes Tempo, drückt unterschiedliche Bedürfnisse aus. So wie der rosarote Panther, wie Deleuze und Guattari feststellten, die Wand rosa anmalt, verändert consonni seine Umgebung, um zu dieser Welt zu werden. Es geht nicht so sehr um Tarnung, sondern um Ansteckung. Um es mit Marina Garcés' Worten zu sagen: Es geht darum, von der Welt beeinflusst zu werden und zu versuchen, sie zu beeinflussen. In diesem Sinne scheinen Werden und Mutation unendlich, solange die Kreatur atmet. Und wenn es aufhört zu atmen, scheint es, als würde es auch durch Geschichten und Erinnerungen mutieren; das ist unkontrollierbar, unendlich. Es sieht so aus, als ob dieses Nomadentum systemisch ist, obwohl es uns vielleicht sogar überraschen könnte, wenn wir dieses variable Wesen kennen, das consonni ist, das ein Eigenleben hat. harriet c. brown ist eine Übung in der Konstruktion eines lumbung-Körpers, einer Identität, die das verkörpert, was kollektiv ist. Es ist ein humanoides Werkzeug. Wenn consonni ein Eigenname sein muss, eine weitere Übung in der Fiktionalisierung, um die Identität zu komplexieren, denn in seiner ständigen Metamorphose ist consonni auch eine Proklamation für fließende Identitäten. consonni ist ein Kunstzentrum, eine Agentur, ein Verlag, eine Fabrik der Kreation. Es ist all das und nichts von alledem. Eigentlich sind das subjektbasierte Identitäten, während es uns darum geht, Identität als wandelbar zu konstruieren, durch ein Prädikat. Durch Handeln und Denken. Subjektidentitäten sind nur in bestimmten Momenten als politische Taktik interessant. Deshalb liegt auch die Variation in der DNA von consonni.
MC: Die Flüchtigkeit von Identitäten, von pluralen Formen des organischen Seins – she-bodies, they-organisms – sind in eurer eigenen Auswahl von Stimmen und Allianzen, im Inhalt dessen, was consonni in seinen Büchern veröffentlicht, sehr präsent. Ich kann mir vorstellen, dass die Debatte um die Komplexität der Identitätspolitik und die Analyse ihrer vielen Falten für euch eine Konstante ist. Heutzutage sind die Nuancen, die Gemeinschaften, Erbschaften, Vermächtnisse, Vorlieben, Orientierungen, Territorien unterscheiden, die Art und Weise, wie man erzählt und sich selbst bezeichnet und verwaltet, die Dimensionen von Identitäten, die in einem dekolonialen, nicht-hegemonialen, nicht-normativen Rahmen anerkannt und gepflegt werden müssen, sehr präsent. Diese Anerkennungen sind immer mit einer befreienden Kraft verbunden, die Bindungen schafft und Potenzen ermöglicht. Inwieweit bilden solche Nuancen, Kräfte und Potenzen, die neuen Identitätskonstruktionen, sagen wir, eine redaktionelle Agenda für consonni?
MM: Ja, insofern, als wir Identität nicht als eine verdinglichte Struktur verstehen, sondern als eine variable Option oder eine politische Strategie, die an der Vielfalt der Identität und damit an der Disparität der Narrative arbeitet, was für uns grundlegend ist. Von [dem indonesischen Kollektiv] ruangrupa haben wir das Konzept des Interlokalen gelernt, das wirklich fruchtbarer ist als das Konzept des Internationalen. Letztendlich gehen wir alle von unseren lokalen Gegebenheiten aus, von dem, was spezifisch ist, von unseren Kulturen, und es ist stark, wenn diese konkreten und spezifischen Realitäten ein Gespräch in Gang setzen. Es ist wichtig, dass es Bibliodiversität gibt, dass eine Vielfalt von Verlagen unterschiedlicher Größe nebeneinander existiert und dass es in jedem Verlag auch eine Vielfalt von Stimmen gibt. Bei consonni entfernen wir uns manchmal von unserer eigenen Identität, während wir zu anderen Zeiten nach dem Anderssein suchen, um Dialoge zu schaffen.
Wir sind derzeit ein mehrsprachiges Team von vier Feministinnen, María Macia, Munts Brunet, Dina Camorino und mir (einige von uns sprechen Galicisch, einige Katalanisch und einige Baskisch), die aus verschiedenen Teilen Spaniens und Argentiniens kommen. Die Kollegin, die sich um die Presse kümmert, Belén García, lebt in Sevilla. Diese territorialen Gegebenheiten spiegeln sich in unserer Übersetzung von Büchern baskischer, galicischer und katalanischer Autoren (Antxine Mendizabal, Uxue Alberdi, Miren Agur Meabe, Eli Ríos, Ada Klein Fortuny) sowie in der Veröffentlichung lateinamerikanischer Autoren wie der Argentinierin Ana María Shua, der Salvadorianerin Jacinta Escudos oder des Kubaners Iván de la Nuez wider. Wir suchen ständig die Schnittstelle zwischen Kunst und Literatur, indem wir Künstler*innen wie die Mexikanerin Verónica Gerber oder die Kolumbianerin Viviana Troya veröffentlichen, die Literatur als Teil ihrer künstlerischen Praxis verstehen. Die fließende Realität der LGTBQ+-Gemeinschaft widerzuspiegeln, ist ebenfalls eine Arbeit, die uns als Team durchzieht, und so übersetzten wir Larry Mitchel und Ned Asta und ihr Buch The fagots & their friends between revolutions, wie von den Übersetzern Jesús Alcaide und John Snyder vorgeschlagen. Von diesem Punkt aus sind die Gespräche und Nuancen, die der rassifizierte Feminismus mit sich bringt, der Grund, warum wir Nivedita Menon oder bell hooks veröffentlicht haben.
In Essayform zeigt Charlene Carruthers und durch Fiktion Akwaeke Emezi die Art und Weise auf, wie der Kolonialismus Menschen und Länder infiziert, und untersucht die Grenzen der persönlichen, sozialen und geschlechtlichen Identität. Wir versuchen auch, nicht nur englischsprachige Stimmen zu übersetzen, um unterschiedliche Interlokalitäten zu wecken. Wie die Übersetzerin Tana Oshima dargelegt hat, geht es beim Übersetzen nicht nur um die Übertragung von Worten, sondern vor allem um die Interpretation von Kulturen. Einen Text zu veröffentlichen, in dem es um Kolonialismus oder Rassenfragen geht, und diese Debatte nicht in die Übersetzung selbst zu integrieren, auch wenn dies zu einer gewissen Entfremdung innerhalb der Übersetzung führt, ist, gelinde gesagt, schockierend. Ähnlich verhält es sich mit der so genannten inklusiven Sprache und der Frage, wie sie zu verwenden ist und wie sie die Lektüre beeinflusst. Anstatt ein einziges Rezept zu erstellen, besprechen wir jeden Fall lieber mit der Person, die den Text unterzeichnet, und der Person, die ihn übersetzt. Eine Übersetzung, die bestimmte Nuancen nicht kennt, kann die Identität und Stärke des Originaltextes zerstören. Auch diejenigen, die die Bucheinbände gestalten, reagieren auf diesen Gedanken der Pluri-Identität, des Dialogs und der verbundenen Interlokalität. Bei consonni fügen die Künstler*innen dem Buchumschlag eine weitere inhaltliche Ebene hinzu. Zanele Muholi hat mit einem ihrer Bilder zum Cover von Charlene A. Carruthers' Buch über queere und schwarze Grundsätze beigetragen. Die deutsche Fotografin und Künstlerin Ursula Schutz-Dornurg hat das Titelbild für Antxine Mendizabals Vínculos beigesteuert, einen Roman über drei Generationen von isolierten Frauen. Die Künstlerin Solange Pessoa arbeitet mit einer Zeichnung an dem nächsten Buch von Vinciane Despret, das wir veröffentlichen werden. Auf diese Weise verflechten wir die Identität wie ein Kaleidoskop, um sie nicht zu einem Pastiche oder instrumentalisierten Exotismus zu vereinfachen, was die Gefahr des Multikulturalismus ist.
Übersetzt aus dem Englischen von Carina Bukuts
María Mur Dean ist seit 1999 Teil des Kampfes von consonni in den Bereichen Verlagswesen und unabhängiges Kulturprogramm. consonni produziert und veröffentlicht seit 1996 kritische Kultur, wird in Kleinbuchstaben geschrieben und ist ein mutiertes androgynes und polyzephales Geschöpf.
Manuel Cirauqui ist Kurator, Autor und Gründungsdirektor von Eina Idea, einer Denkfabrik und Programmplattform am EINA University Center of Design and Art der Autonomen Universität Barcelona.
[…]
„Ganz ehrlich. Es muss ein wenig wie dieses eine Foto von dir sein, der Blowup verfälscht den Kontext: Man muss die Dinge aus der Distanz betrachten. Méfiez-vous des morceaux choisis.“
Antonio Tabucchi, Indian Nocturne1
„Etwas Großartiges ist passiert. Diese Fotos im Park, großartig! Jemand hat versucht, jemand anderen umzubringen. Ich habe sein Leben gerettet.“
Michelangelo Antonioni, Blow up2
A.
Zwei Anhaltspunkte für die Leser*innen:
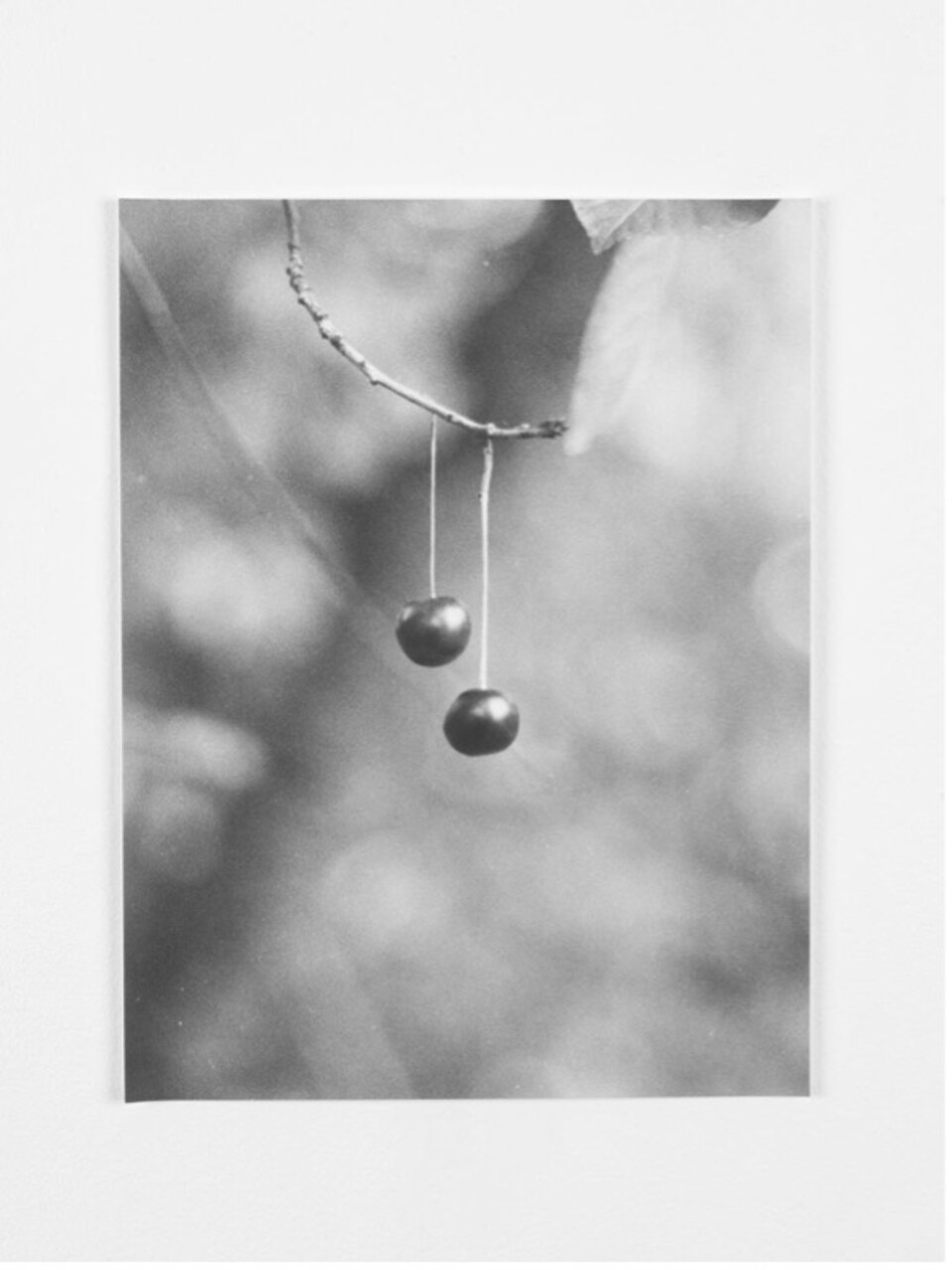
Jochen Lempert, Kirschen, 2019, © Jochen Lempert/VG Bild-Kunst, Bonn 2022. Courtesy BQ, Berlin und ProjecteSD, Barcelona
1.
„Nehmt euch vor den ausgewählten Stücken in Acht!“ (Es könnte auch stehen für „Nehmt euch vor der Rosinenpickerei in Acht“ …)
Empfehlung des Charakters in Antonio Tabucchis Indian Nocturne.
2.
Was den Fotografen in Blow up angeht: Er hat niemanden gerettet. Zwar dachte er das zunächst, es stellte sich jedoch als Täuschung heraus.
Mit der Vergrößerung (dem Blowup) der Fotos findet der Fotograf allerdings „den Fakt“ heraus, etwas, das er mit bloßem Auge zunächst kaum erkennen konnte. Er streckt das Bild, und genau in diesem Augenblick scheint es, als ob der fragliche Gegenstand (und damit das gegenständliche Bild) mit einem Mal klarer und verschwommener zugleich ist. Die wahrnehmbaren Elemente aller Subjekte scheinen stillzustehen, in Form einer Explosion – oder genauer gesagt, wie zu Beginn einer solchen. Und doch können wir in diesem Augenblick – obwohl wir weniger sehen können und die Konturen inmitten der Körnung des Bildes verschwimmen besser sehen. Oder etwas Neues erkennen, etwas Unerwartetes.
Wenn wir ganz genau hinschauen, können wir erkennen, dass alles, was wir sehen, sich aus derselben Substanz zusammensetzt. Betrachter*innen, die sich im Raum vor den Fotografien von Jochen Lempert auf eine Art myopischen Tanz einlassen und die größten und kleinsten Bilder in der Kunsthalle Portikus aus verschiedenen Distanzen in den Blick nehmen, können den für sie passenden Blickwinkel finden und damit spielen. Wir könnten uns das Ganze auch als tänzerisches Spiel der Blicke vorstellen.
B.
Laut einem etymologischen Wörterbuch stammt das Wort „coincidence“ [dt.: Zufall, Anm. d. Ü.] etwa aus dem Jahr 1600. Damals bedeutete es: „exakte Übereinstimmung in Substanz und Natur“, während etwa um 1640 herum „coincidence“ erstmals im Sinne von „Ereignis oder Existenz zur gleichen Zeit“ Verwendung fand und schließlich als „Gleichzeitigkeit von Ereignissen ohne augenscheinliche Verbindung, zufällige oder beiläufige Übereinstimmung“ verstanden wurde.
Zum Zwecke dieser Untersuchung sollten wir uns an der ersten Definition orientieren: „die exakte Übereinstimmung in Substanz und Natur“. Und tatsächlich ist es überhaupt kein Zufall, dass die Fotografien hier sowohl für ihre eigene Konstellation als auch für den Ausstellungsraum von zentraler Bedeutung sind. Beim Betreten des Portikus sind keine vermittelnden Apparate zu sehen, kein Glas, keine Passepartouts, keine Rahmen. Die Fotografien sind direkt an der Wand angebracht. Nackt wie sie sind, werden sie Teil der Architektur selbst.
Wenn wir über den Unterschied zwischen „Auswahl“ und „Entscheidung“ in einer Ausstellung sprechen, so die Kuratorin Yasmil Raymond, kann Auswahl als die Ermöglichung und Befähigung zur Selektion verstanden werden kann, während Entscheidung einen Entschluss, ein Urteil, einen praktischen Entschluss darstellt. „Sie stellt einen Einschnitt dar“, sagt Raymond, während sie mit den Fingern den Scherenschnitt andeutet. SCHNIPP. Diese Metapher passt perfekt, wenn sie auf dieses fotografische Werk angewandt wird. Jochen Lempert entscheidet, also schneidet er. Für jede Ausstellung besucht er den Ausstellungsraum, mit einer großen Auswahl an Fotografien aus seinem Archiv im Gepäck. Und erst dann entscheidet er, welche unter den gegebenen Umständen gezeigt werden sollen. Ist die Entscheidung getroffen, nimmt er die Schnitte an den Drucken vor, direkt vor Ort. Keine Eindeutigkeiten. Die bewusst und vorsichtig neu gestalteten Fotografien verwandeln sich dadurch in etwas Neues, sie unterscheiden sich damit nunmehr von den Pendants in den Archiven des Künstlers. Und während die Fotografien gleichermaßen Duplikate und ungewöhnliche Einzelstücke sind, werden sie mit jeder Ausstellung auch Teil einer neuen Konstellation (dem Hier und Jetzt) sowie einer kontinuierlichen, stetig weiterwachsenden Sammlung (die mit allen anderen Lempert-Ausstellungen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbunden ist).
C.
Im Gespräch über die Auswahl der Fotografien in den Vitrinen im unteren Geschoss weist Deborah Müller, die Ko-Kuratorin der Ausstellung, darauf hin, dass Jochen Lempert immer an der Verbindungsstelle zwischen Bäumen und Erde interessiert war. Es ist besonders spannend, sich über die Gründe dafür Gedanken zu machen. Denn bei diesem Prozess des Nachdenkens kommen wir zum Schluss, dass es sich um einen ganz speziellen Schwellenbereich handelt, der nicht genau definiert ist: Es ist nicht möglich, in diesem einen klaren Schnitt anzusetzen. Zudem ist das genau der Ort, wo wir – mit den Bäumen als Mittlern – die Verbindung von Luft und Erde wahrnehmen. Bäume als Wesen, die die Erde mit der Sonne und dem Kosmos verbinden. Sie verwurzeln sich tief in der Erde, und was man von ihnen sieht, ist nur ein Teil, ein Detail, scheinbar vom Rest des Kontextes abgeschnitten. Sie sind wie Indizien, die darauf verweisen, dass es außerhalb des unmittelbar Sichtbaren immer auch etwas Anderes zu entdecken gibt.
D.
Ganz im Stile eines Warburg’schen Mnemosyne können die Betrachter*innen die Fotografien in unterschiedlichster Reihenfolge und Richtung erkennen, erfahren und erinnern. Im oberen Stockwerk können die über den Raum verteilten und in unterschiedlichen Höhen angebrachten Bilder auf vertikale, wie auf horizontale Weise betrachtet werden; im unteren Stockwerk finden wir sie sowohl auf gleicher Höhe an der Wand angebracht als auch in vier horizontal nebeneinander angeordneten Vitrinen, wie Bücher in einem Regal. Die Augen sind stets aufgerufen, sich an die unterschiedlichen Proportionen anzupassen, sie können nie wirklich ruhen. Der Blick gleitet über ein Geflecht aus Positionen und Größen hinweg, hält inne, geht hin und wieder zurück. Denn über die Ausstellung verteilt sind sehr viele Verweise versteckt, anhand derer man regelmäßig Elemente wiedererkennt und sie mit bereits im Gedächtnis abgespeicherten Informationen sowie neu geformten Erinnerungen mit anderen Ausstellungsstücken zu Paaren zusammengestellt. Es ist ein Spiel mit Querverweisen zwischen sich ähnelnden Details, die den Geist an einen anderen Ort und aus dem Rahmen herausführen. Eine Reise durch Raum und Zeit inmitten von Feldfrüchten, die die Betrachter*innen konstant an etwas anderes erinnern.
Wie beim Kirschenessen, wenn man nie zu naschen aufhören kann.
E.
Zwei Kirschen werden mit den Augen eines Frosches zu einem Paar zusammengestellt und bringen sich mit den Bäumen jenseits der Fenster in Verbindung. Dann zu einem schachbrettartigen Baumstamm. Das Bild eines Blatts ähnelt der Karte einer Stadt.
Und wenn auch die Koralle als solche bezeugt, dass ihre Form ein Resultat der Meeresströmungen und äußeren Umständen ist, lässt die allein Drucken gemeinsame Körnung, diese eigentliche Materie der Bilder, die die Betrachter*innen dazu verleitet, Verbindungen herzustellen. Alles scheint als und ist die exakte Übereinstimmung in Substanz und Natur von etwas anderem. Oder von allem anderen.
Es ist gleichzeitig ein kurzer Augenblick und die Gesamtheit der Geschichte. Ein Marienkäfer, ein Auto, eine Konsolenhalterung, ein Teil eines Gemäldes, ein Flugzeugfenster.
SCHNIPP.
Sie greifen aufeinander über.
Im Rahmen der Ausstellung Pierre Verger in Suriname lädt Willem de Rooij die Künstler*innen Razia Barsatie, Ansuya Blom, Ruben Cabenda und Xavier Robles de Medina ein, ihre Werke auf der Portikus-Website zu zeigen. Das Programm Flux und Reflux – A Selection of Moving Images stellt vier zeitgenössische Künstler*innen vor, die einen Bezug zu Surinam haben. Die Videoarbeiten werden jeweils für zwei Wochen online verfügbar sein:
01.07.–14.07.2021
Razia Barsatie
A no san fesi e sori, ati e tyari, 2021
(wat niet op het gezicht te zien is, draagt 't hart m.a.w. het uiterlijk is anders than het innerlijk)
Video-Installation
8,3 m x 5,1 m
Holzkohle, Gips, Mehlteig, Kampfer, Tapioka, Küchenreinigungstuch, Marker, dreizehn kleine Motoren
Basierend auf ihrem fiktiven Theaterstück »A no san fesi e sori, ati e tyari« zeigt die gleichnamige Videoinstallation eine chaotische Atmosphäre zwischen dem tief verwurzelten Unterbewusstsein und dem bewussten Verstand der Protagonistin, Christien. Gefangen zwischen Einsamkeit, Hass, Trauma, Vertrauen und Verwirrung, fragt sie sich, wie sie jemandem etwas erklären kann, wenn sie es selbst nicht einmal versteht. Die Installation erzeugt abstrakte und konkrete Wiederholungen – mehrere auf Holzkohle gestapelte Fingerskulpturen werden von Wandzeichnungen begleitet. Im Rhythmus der Installation schafft Barsatie eine Meditation des Raumgebens, der Verbrennung des inneren Gedankens, der Verarbeitung und des Loslassens.
Razia Barsatie (*1982 in Paramaribo) lebt und arbeitet in Amsterdam, wo sie ihre Forschungen über Geruchserhaltung, Erinnerung und das Häusliche als Raum emotionaler Unterdrückung fortsetzt. Sie absolvierte die Rietveld-Akademie und ist derzeit Resident an der Rijksakademie in Amsterdam. Zu ihren jüngsten Ausstellungen gehören Nieuwe Kerk Amsterdam, Nieuw Dakota und Theater Thalia in Amsterdam, Künstlerresidenzen und Ausstellungen in Moengo, Surinam, Thami Mnyele Foundation Award in Amsterdam, CARMA in Französisch-Guayana und das Caribbean Linked III Atelier '89 in Aruba.
Song Credits:
Maa-mujhe-apne-aanchal | Sängerin: Fariz Barsatie
Maa-ki-dua-jannat-ki-hawa |Sänger: Muhammad Hassan Raza Qadri
Stimme:
Daniel Aguilar Ruvalcaba | Diana Cantarey | Özgür Atlagan | Salim Bayri | Aldo Esparza Ramos | G | Lungiswa Gqunta | Claudia Pagés Rabal | Tomasz Skibicki | Mette Sterre | Sungeun Lee | Anh Tran
Dank an:
Schrijversvakschool | Vincent Reit | Faaria Kasiem | Niaaz Kasiem | Ansuya Blom |
Annelie Musters | Ratu Saraswati | Elke Uitentuis
Installationsaufnahmen: Courtesy of the Artist and Rijksakademie Archive
Porträtbild: Marjet Zwaans
Website der Künstlerin:
Im Rahmen der Ausstellung Pierre Verger in Suriname lädt Willem de Rooij die Künstler*innen Razia Barsatie, Ansuya Blom, Ruben Cabenda und Xavier Robles de Medina ein, ihre Werke auf der Portikus-Website zu zeigen. Das Programm Flux und Reflux – A Selection of Moving Images stellt vier zeitgenössische Künstler*innen vor, die einen Bezug zu Surinam haben. Die Videoarbeiten werden jeweils für zwei Wochen online verfügbar sein:
17.06.–01.07.2021
Ruben Cabenda
Nieuwe herinneringen aan oude huizen, 2019

Ruben Cabenda entwickelt seine Animationsfilme aus Ideen, Skulpturen, Zeichnungen und Gemälden, die ihm dazu dienen, Fragen der Identität und des kulturellen Erbes, der Religion und der Sklaverei zu behandeln und synthetisiert in ihnen neue Ideen. Als Loops präsentiert, machen sie sich durch ihre Wiederholung die Kraft des bewegten Bildes zunutze.

Ruben Cabendas Animationsfilme untersuchen die Auswirkungen des Erbes der Sklaverei auf die Menschen in Surinam und das fortbestehende koloniale Erbe, das noch immer den Alltag dort mitbestimmt. Der Künstler beobachtet und reflektiert, wie die Menschen in Surinam sich mit ihrem kulturellen Erbe auseinandersetzen, versuchen, sich davon zu lösen und wie dies ihre Vorstellung von „Selbst" beeinflusst. Identitätspolitik, sowohl global als auch in Surinam, steht im Mittelpunkt seiner Arbeit. Mit seinen Animationen versucht er, das Bewusstsein der Betrachter*innen für ihre eigene Identität und Herkunft zu schärfen.
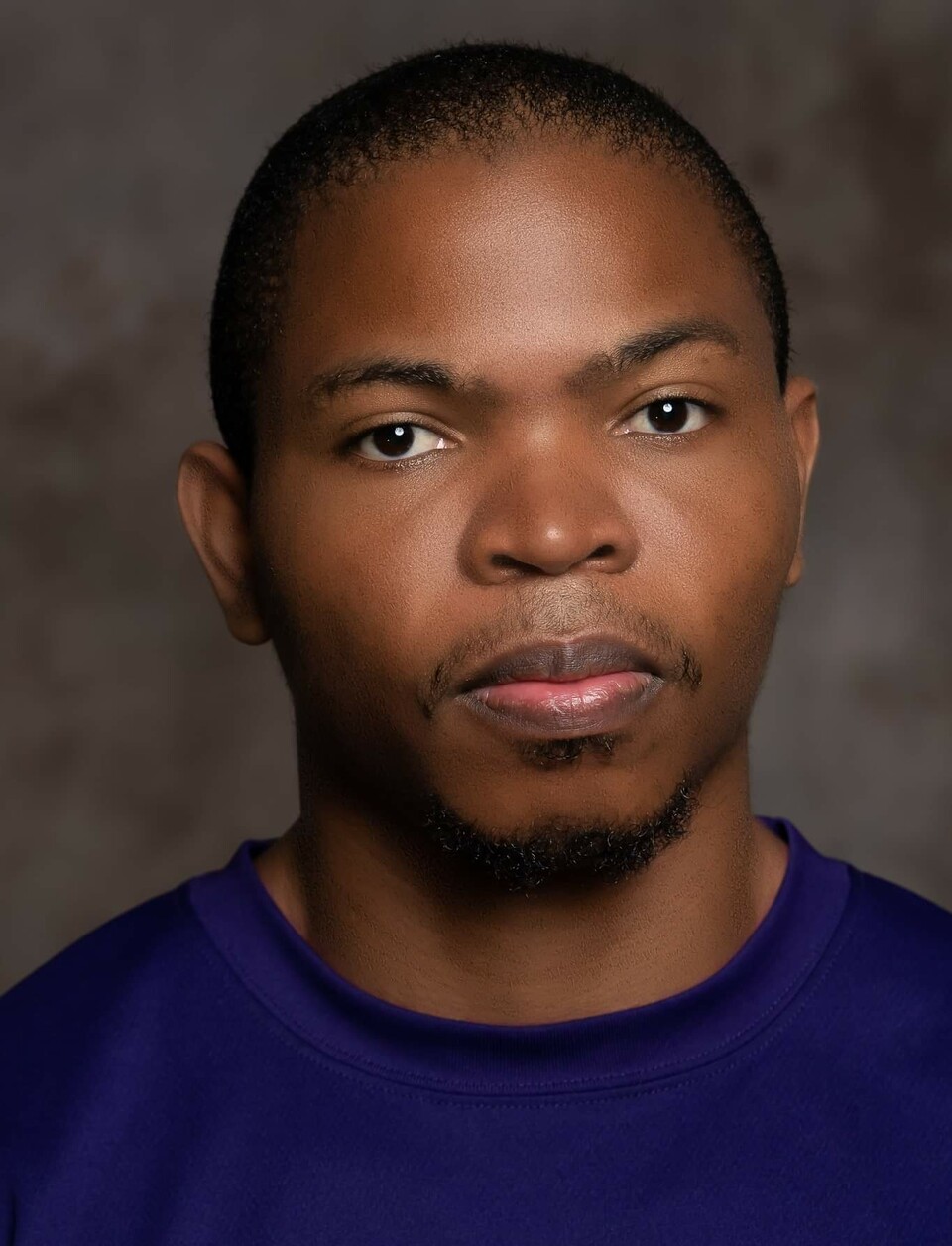
Ruben Cabenda (*1989 in Paramaribo) lebt in Paramaribo. Er absolvierte die Nola Hatterman Art Academy in Paramaribo, wo er bis 2018 unterrichtete sowie die Rietveld Academy in Amsterdam. Ausgewählte Ausstellungen umfassen die National Gallery of Jamaica, Moengo Festival of Visual Arts, Nest Lowlands, Oude Kerk, Amstelkerk und Prinsenkwartier in Amsterdam, die Kunstvereniging Diepenheim und No Man's Art Pop-up Gallery Teheran.
Bevorstehende Künstler*innen in der Programmreihe:
24.06.–08.07.2021
Ansuya Blom
01.07.–15.07.2021
Razia Barsatie
Im Rahmen der Städelschule Lectures sprachen Angela Lühning, Carl Haarnack, Oliver Hardt und Willem de Rooij im November 2020 über historische Bildwelten aus Surinam.
Gäste:
Angela Lühning - Direktorin der Stiftung Pierre Verger, Salvador da Bahia
Carl Haarnack - Kurator, Schriftsteller und Archivar, Gründer von Buku - Bibliotheca Surinamica, Amsterdam
Willem de Rooij - Künstler und Pädagoge, Berlin
Moderiert von Oliver Hardt - Filmemacher, Frankfurt am Main
Sind wir außerhalb der Ausstellungshalle noch ständig konfrontiert mit einer gewissen aufgewühlten Unruhe angesichts der globalen Pandemie, so tritt uns innerhalb der Ausstellung eine zuversichtliche, fast humoristische Stimmung entgegen. Dies könnte auch als Reaktion auf die letzten Monate gelesen werden, die alles andere als strikt, geplant oder greifbar waren. Der Blick in die Zukunft ist nicht nur der Absolvent*innenausstellung per se und der Natur eines Studienabschlusses inhärent, sondern auch in der optimistischen Atmosphäre der Arbeiten.
L’Esprit lautet der Titel der diesjährigen Absolvent*innenausstellung der Städelschule, die einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft richtet. Mit Geist oder Verstand kann der französische Begriff übersetzt werden, der auch im Deutschen verwendet wird. Eine Person mit Esprit könnte auch mit den Adjektiven geistvoll oder gewitzt beschrieben werden – eines hat diese Begriffsgruppe allerdings gemeinsam: die Konnotation fällt positiv und schwungvoll aus, wenn die einhergehende Stimmung beschrieben werden müsste. Genauso wenig wie der Geist greifbar ist, ist auch der Esprit nicht materiell, nicht fassbar und verweist lediglich auf eine auratische Dynamik, mit der die Räume des Portikus durchschritten werden können.
22 Absolvent*innen aus allen Klassen der Städelschule stellen im Portikus ihre medial unterschiedlichen Werke aus: sowohl Malerei und Bildhauerei als auch Video- und performative Kunst ist ausgeglichen vertreten. Mag es auf den ersten Blick scheinen, als wären die Kunstwerke in dem nicht allzu großen Gebäude auf der Maininsel dicht gedrängt, so wird man schon im ersten Ausstellungsraum vom Gegenteil überzeugt. Wir fragen uns, ob wir vielleicht im Zuge der letzten Monate schlichtweg sensibler geworden sind, was den Umgang mit Raum betrifft? Auf den privaten Raum sind wir verstärkt verwiesen, wobei der öffentliche umsichtiger begangen wird.
Für L’Esprit werden im Portikus nicht nur die große Halle und das Mezzanin als Ausstellungsfläche benutzt, sondern auch der Shop, das Büro und der Garten. So stellten sich die Kurator*innen Sophie Buscher und Alke Heykes der Herausforderung, jeder Arbeit genug Raum zu geben. Das Ergebnis kann kaum in Frage gestellt werden – schnell ist man davon überzeugt, dass jedes Werk seinen eigenen Platz gefunden hat und sie dennoch miteinander in einen Dialog treten können. Wir überlegen uns, ob sich das auf die Graduierten und ihre Zeit an der Städelschule und in Frankfurt übertragen lässt?
Sinnbildlich wird diese Frage von Matt Welch beantwortet, der in seiner Skulptur Mechanical assimilation into a bad environment (die Verdauung) (2020) das Innere eines überdimensionierten Magens darstellt. Das Verdauungsorgan ist aus Glasfaser und Harz gefertigt und das Innere, das dort zum „Verdauen“ bereit liegt, besteht aus Geschirr und Essensresten. Auf einen zweiten Blick lassen sich die Teller und Tassen als Eigentum der Mensa der Städelschule identifizieren. Es stellt eben einen großen Schritt dar, die behütende Kunsthochschule zu verlassen, die den Künstler*innen Freiheit zum Experimentieren gibt, und sich nun auf eigenen Beinen einen Weg durch die Kunstwelt zu bahnen. Wie ein Fels in der Brandung lässt die Arbeit Interface (2020) vom Künstlerduo Timon und Melchior Grau den Portikus in regelmäßigen Sequenzen aufleuchten. Ihre Installation befindet sich auf dem Mezzanin und besteht aus drei kokonförmigen Objekten, die wie milchglasige Leuchten anmuten. Sie beschäftigen sich in ihrem Werk hauptsächlich mit den Grenzen zwischen Design und Kunst und der Verortung von Objekten und Subjekten innerhalb dessen. Die Arbeit, die für die Absolvent*innenausstellung entstanden ist, lässt dennoch weitere Interpretationsräume offen. Die Künstlerin Živa Drvarič spielt ebenfalls mit unseren Sehgewohnheiten und normativen Funktionalitäten von Objekten. Ihre Arbeiten befinden sich sowohl im Unter- als auch im Obergeschoss der Ausstellungshalle und präsentieren sich in einem neutralen, sehr klaren Gestus. Beispielsweise die Arbeit Emptiness (2020) erhebt zwei Glasflaschen ihrem Nutzen und lässt sie flach übereinander liegen. Vielleicht auch ein Blick ins vorerst Leere oder Ungewisse, allerdings aus einer optimistischen, experimentellen Perspektive? Vor einem Fenster im Untergeschoss hängt eine der drei gezeigten Werke des Künstlers Shaun Motsi. Die kleinformatigen, mit pastosem Farbauftrag angefertigten Malereien interessieren sich auf ihre Weise ebenfalls für Fragen nach Sichtbarkeit und Blickrichtungen. In der Arbeit Bad-Bar Blues(2020) ist eine hinter einer Pflanze versteckte Skulptur eines Schwarzen Saxophonspielers abgebildet, die ursprünglich als Dekorationsobjekt diente. Der Künstler hinterfragt die koloniale und exotisierende Geste, die in dem Objekt steht, ohne der Betrachter*in einen direkten Blick auf die Figur zu gewähren: so ist sie nur schemenhaft erkennbar. Die Videoinstallation von Yong Xiang Li und die Arbeiten von Johanna Odersky eröffnen in einer verspielt-romantischen Ästhetik einen Blick auf Beziehungen zwischen dem Menschen und seiner Innen- und Außenwelt. Steht bei Odersky vor allem die Zärtlichkeit ihrer Skulpturen im Mittelpunkt, eröffnet Xiang Li in seiner Adaption eines Romans eine utopische Welt, die Grenzen zwischen Spezies aufbricht. Dies lässt beide Arbeiten für die Besucher*innen in einen Dialog treten. Die Videoarbeit von Andrew Wagner vermag es mit ihrer linearen, humoristischen Narration ebenfalls, die Betrachter*innen in ihren Bann zu ziehen – ebenso wie die vielen weiteren Arbeiten in L’Esprit.
Der Portikus eröffnet uns mit der Ausstellung einen Gegenpol zur alltäglichen Unruhe. Die Absolvent*innenausstellung ermöglicht Einblicke in 22 verschiedene Praxen, die ihre selbstbewussten, individuellen Handschriften deutlich machen – so kann ihnen nur das Beste für ihren Weg hinaus aus dem sicheren Hafen der Kunsthochschule gewünscht werden.
Louisa Behr, BA Kunstgeschichte und Theater- und Medienwissenschaft, ist derzeit Studentin des Masterprogramms Curatorial Studies an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule und der Goethe Universität Frankfurt/Main.
Johanna Weiß, BA in Kulturwissenschaften und Kunstgeschichte, studiert seit Herbst 2019 im Master Curatorial Studies an der Hochschule für Bildende Künste – Städelschule und der Goethe Universität Frankfurt/Main.
"Zahl" von Levi Easterbrooks
"Kopf" von Janique Préjet Vigier

Moyra Davey, Hell Notes (still), 1990/2017.
Zahl:
Was an den andren Waren vergeht, ist eben ihre Form; aber diese Form gibt ihnen ebenso den Tauschwert, während ihr Gebrauchswert im Aufheben dieser Form, der Konsumtion, besteht. Beim Geld dagegen ist seine Substanz, seine Materialität, die Form selbst, in der es den Reichtum repräsentiert. Wenn das Geld als an allen Orten, der Raumbestimmung nach allgemeine Ware erscheint, so jetzt auch der Zeitbestimmung nach. Es erhält sich als Reichtum in allen Zeiten. Spezifische Dauer desselben. Es ist der Schatz, den weder die Motten noch der Rost fressen.1
Aber was, wenn das Geld verschlungen und später dann wieder völlig unversehrt ausgeschissen würde? Sein Wert würde, trotz seiner elenden Entwürdigung in menschlichen Eingeweiden, erhalten bleiben. Sein sozialer Wert hingegen könnte ins Bodenlose fallen, wenn es mit Scheiße in Kontakt gekommen und durch sie hindurchgegangen wäre, und es würde noch lange, nachdem es gesäubert worden wäre, Ekel auslösen.
Durch diese Passage vom Mund zum Anus oder, in konventionellerem Gebrauch, von der einen Hand zur andern oder vom Portemonnaie in die Kasse, können sich, ungeachtet des durch die metallische Substanz einer Münze gegebenen Eindrucks von Dauerhaftigkeit, im Laufe der Zeit minimale Abreibungen und Abtragungen ansammeln. Gegen Marx ist ein Kupferpfennig metallisches Geld, das oxidiert und rostet. Seine Bewegung bringt auch Verschleiß und die allmähliche Anhäufung von Schmutz, Schleim oder anderen Ausscheidungsstoffen mit sich, mit denen die Straßen der Städte ebenso wie die Finger überzogen sind, die sie verdrossen in Spardosen fallen lassen oder in Wunschbrunnen werfen. Auch wenn die Oberfläche eines Pennys im Licht strahlen mag, ist sein metallischer Glanz, trotz des kühlen institutionellen Affekts, den silberne Türen und Drehkreuze erzeugen, nicht gleichbedeutend mit dem Sauberen oder Hygienischen. Hinter dem warmen reflektierten Licht des Kupfers kann sich eine pockennarbige Oberfläche mit Scharten und Schrammen verbergen, wo sich der Schmutz in den Spuren prekärer Dauerhaftigkeit versteckt. Ohne Makroobjektiv oder einen Test auf Bakterienkulturen bleibt dieser Dreck unter dem spiegelnden Kupferschein trotz aller verbreiteten Mahnungen, dass Geld schmutzig sei, meistenteils unbemerkt. Diese moralistischen Mahnungen sind im Allgemeinen zweideutige Verunglimpfungen von Sexarbeitern und Bettlern. Hier ist Kleingeld zwischen jenen im Umlauf, die als sozial und physisch unsauber bestimmt sind.
Ein Freund aus der High School steckte sich einmal einen Penny in seinen Anus, holte ihn wieder heraus und warf ihn einer Gruppe von Freunden auf der Couch zu, die sofort voller Ekel auseinanderstob. Abgesehen von der komischen Übersteigerung, die diese Geste aus der Verbindung von Münzgeld und dem Analen machte, ließ sie auch deutlich werden, weshalb Geld im Prozess seiner fäkalen Abjektion und langsamen Auflösung im Tausch seinen Wert erhält. „Wir schätzen Geld, weil wir unsere Scheiße schätzen.“2
Wie Exkremente ist Münzgeld vom menschlichen Körper ablösbar, kann ungehindert durch Kanäle des Austauschs und der Wertverwandlung fließen, die über einzelne Personen hinausgehen. Seine Wandel- und Veränderbarkeit erlauben es dem Geld, als Währung zu fungieren, die beim Kauf von Waren verschiedener Art akzeptiert wird. Einige wenige Münzen sind gleich einem Abstecher zur Bahnhofstoilette ebenso wie einer Tafel Schokolade oder einem Paket Butter.
Moyra Davey, Auszug azs Hell Notes, 1990/2017, Super-8 Film mit Ton, übertragen auf HD Video, 26 min. 16 sec.
Kopf:
Wie jedes Kind, das Pfennige auf die Zunge nimmt, also: wie jedes Kind, erinnere ich mich an ihren Geschmack; sie schmeckten genau wie Blut. Diese Handlung war durch eine gewisse Langeweile angeregt, aber auch durch ein vorläufiges Verständnis von Wissen: etwas zu wissen würde heißen, es ganz aufzunehmen. Die Münze wie das Abendmahl zu nehmen war ein Weg, etwas Öffentliches privat zu machen, zu etwas Geheimen. Letztendlich wusste ich, dass es dreckig war, und war dennoch auf ambivalente Weise zu diesem neu entdeckten Spiel hingezogen, ebenso beeindruckt wie angeekelt von mir selbst. Indem ich Münzen in meinem Mund herumwälzte, lernte ich etwas, wofür ich Jahre brauchte, um es wieder zu vergessen: Geld ist das dreckigste Ding. Das hält die Menschen nicht davon ab, es haben zu wollen.
Wann immer sie es gelernt haben mag, Moyra Davey hat es nicht vergessen. Seit Anfang der 1990er Jahre produziert die Künstlerin beständig Arbeiten, die sich auf die Psychologie des Geldes und dessen freudianische transformative Eigenschaften beziehen: Scheiße zu Gold, eine Märchenfantasie. Ihr Video Hell Notes aus dem Jahr 1990 führt die Korrelation zwischen Geld und Begehren auf. Unlängst digitalisiert und im Collective for Living Cinema zum ersten Mal seit 1991 präsentiert, fragmentiert das Video die räumlichen Beziehungen zwischen der Errichtung New Yorks, der manuellen Arbeit des Unbewussten neben Diskussionen über Geld und Scheiße, Exzess und Verausgabung.
Da Begehren eine Form des Hungers ist, sind Essen und Exkremente nie weit vom Geld entfernt. In ihrem Text über Appetit und Verlangen, Magerkeit und Produktivität aus dem Jahr 2014, Spaziergang mit Nandita, schreibt Davey: „Sobald ich versuche ‚Sprache oder Hunger‘ zu denken, ersetze ich unweigerlich Hunger mit essen, nicht essen und scheißen. Hunger ist etwas anderes.“3 Der Wille, nicht die Notwendigkeit begründet das abgründige Verhältnis zwischen Essen, Hunger und Transformation. Hell Notes endet damit, dass die Künstlerin Pennies aus Schmalz herausklaubt und sie in einer gusseisernen Pfanne brät, in der das Fett um die Münzen brodelt. Auf weitschweifige, zufällige, unerwartete Weise auf sich selbst zurückgewendet, wie es bei Daveys Arbeit häufig der Fall ist, beginnt ihr Video Fifty Minutes aus dem Jahr 2006 damit, dass die Künstlerin über ihre Beziehung zu dem sich verändernden Inhalt ihres Kühlschranks nachdenkt. „Ich gewinne eine unverwechselbare Freude daraus, dabei zuzuschauen, wie sich der Inhalt des Kühlschranks verringert, zu sehen, wie die Räume zwischen den Nahrungsmitteln größer werden und sich schärfer voneinander abgrenzen. […] Mein Ziel mit dem Kühlschrank ist: ihn zu öffnen und so viel wie möglich von seinen sauberen, weißen, leeren Wänden sehen zu können.“4
Ich bin überzeugt, dass sich in dieser Arbeit des Entleerens irgendwo eine Verbindung zur Entschaffung findet, jenem Begriff, den die französische Philosophin und Mystikerin Simone Weil für ihr Projekt der Selbstauflösung prägte. Sie definiert diesen Neologismus mit größter Klarheit in Schwerkraft und Gnade: „Entschaffung: Erschaffenes hinüberführen in das Unerschaffene. Zerstörung: Erschaffenes zurückführen in das Nichts. Schuldhafter Ersatz der Entschaffung.“5 Dies führte nicht nur zu einer Philosophie, sondern zu einem täglichen Körperregime. Weil beschränkte ihre Nahrungsaufnahme auf die Menge, die ihrer Einschätzung nach dem entsprach, was die Franzosen damals unter deutscher Besatzung aßen, und starb an Unterernährung. Sprache oder Hunger. „Der Körper ist ein Hebel für das Heil“, schrieb Weil in Schwerkraft und Gnade. Doch auf welche Weise? Was ist die richtige Weise, ihn zu benutzen?
Übersetzung aus dem Englischen: Robert Schlicht
Ausstellung: Moyra Davey, Hell Notes
Wie könnte eine durch Video erzählte Nebengeschichte des Portikus aussehen? Helke Bayrles Portikus Under Construction liefert die Bilder zu dieser Geschichte, indem es ein institutionelles Gedächtnis und eine Reihe von Kunstwerken aus dem konstruiert, was beinahe immer getilgt und ausgeblendet wird: die Arbeit, die in den endgültigen, der Öffentlichkeit präsentierten Installationen im Hauptsaal außen vor bleibt. Auch wenn die in diesem Screening-Programm gezeigten Kunstwerke an sich keinesfalls Nebenwerke sind, operieren sie außerhalb der Grenzen früherer Beiträge, die diese Künstler zum Vermächtnis der Ausstellungen im Portikus geleistet haben. Fast keiner dieser Filme oder Videos wurde zuvor in den Sälen des Portikus gezeigt, doch in ihrer Summe und in ihrer Abweichung von der Norm bieten sie ein Vehikel zur Reflexion. Diese Beziehungen sollen sich durch die Methoden des Programms ziehen, und so werden Zusammenstellungen aus Filmen und Videos den Wert des Mangels, des Ungewissen, des Sekundären, des Dunklen, des Vergessenen und des Nichtklassifizierbaren beleuchten. Von Bayrle inspiriert, versucht das Projekt, aus diesen uneindeutigen Positionen eine Nebengeschichte des Portikus zu konstruieren.
Programm:
19.07.2017
1. Filming Lack
-Martha Rosler, Secrets From the Street: No Disclosure (1980)
-Thirteen Black Cats, Corpse Cleaner (2016)
26.07.2017
2. Dara Friedman
-Dara Friedman, Dancer (2011)
Dancer wurde im Portikus gezeigt und ergänzte damit die Präsentation einzelner Fragemente, die im Rahmen von Portikus XXX im Flughafen Frankfurt geziegt wurden.
02.08.2017
3. Procession/Parade
-Dieter Roth, Dot (1960) and Pop 1 (1957-1961)
-Josef Strau, Untitled (slide projection) (2012)
-Nina Könnemann, Pleasure Beach (2001)
-Mike Kelley, Bridge Visitor (Legend-Trip) (2004)
-Jimmie Durham, Smashing (2004)
09.08.2017
4. Sound Bleed
-Minouk Lim, New Town Ghost (2005)
-Basel Abbas & Ruanne Abou-Rahme, Collapse (2009)
-Lawrence Abu Hamdan, The All Hearing (2014)
-Dan Graham, Minor Threat (1983)
-Dan Graham & Glenn Branca, Performance and Stage-Set Utilizing Two-Way Mirror and Video Time Delay (1983)
16.08.2017
5. Non-work
-Frances Stark, Cat videos (1999-Present)
At Home 1999/1999 (w/ Stephen Prina’s The Achiever) (1999)
Thinking About Writing (w/ Joan Didion interview on public radio) (2001)
At My Desk (w/ Björk’s “Pluto”, circa 1997) (2002)
-Helke Bayrle, Portikus Under Construction (1992-Present)
Frances Stark (2008)
Morgan Fisher (2009)
-Morgan Fisher, Standard Gauge (1984)
Eine Schriftensammlung von Mike Kelley trägt den Titel „Minor Histories: Statements, Conversations, Proposals“.1
Bei den Texten handelt es sich insofern um Sekundärwerke, als sie nicht im Mittelpunkt seiner Ausstellungen standen, sondern eher den textlichen Rahmen für Kunstwerke und Videos bildeten. Wenn Kelleys Skulpturen und Videos im Vordergrund von Ausstellungen stehen, in denen nur wenige oder gar keine Texte gezeigt werden, dann könnte man sagen, dass die betreffenden Texte sekundär sind (oder gemacht werden), auch wenn sie vielleicht einen wesentlichen Anteil an Kelleys Kunst haben. Was an den Rand des Bewusstseins gedrängt wird, was in dieser Weise untergeordnet wird, ist immer auch nebensächlich (minor). Das Nebensächliche ist das, was im Verhältnis zu einem größeren Projekt – in diesem Fall eine Kunstausstellung – von geringerer Bedeutung ist. Andererseits könnte man die Bedeutung großer Werke aber auch durch die Brille von Voraussetzungen betrachten, die durch nebensächliche Materialien erst geschaffen werden. Kelleys „Minor Histories“ nehmen Einfluss auf das Verständnis seiner bedeutenden Werke, da die Texte seine Werke im Nachhinein verändern, indem sie etwas hinzufügen, das vorher nicht zugänglich war. Dieser Schritt – vom Hauptsächlichen zum Nebensächlichen, von Makro zu Mikro – ist auch ein Merkmal der Mikrogeschichte als einer geschichtswissenschaftlichen Forschungsrichtung. In einem Vorwort zur italienischen Ausgabe von „Der Käse und die Würmer: Die Welt eines Müllers um 1600“ (eine der ersten mikrohistorischen Studien), schreibt der italienische Gelehrte Carlo Ginzburg:
In der Vergangenheit konnte man Geschichtswissenschaftlern vorwerfen, dass sie nur an den „großen Taten der Könige“ interessiert seien, doch das trifft heute sicherlich nicht mehr zu. Sie beschäftigen sich immer häufiger mit dem, was ihre Vorgänger stillschweigend übergangen, verworfen oder schlichtweg ignoriert haben. „Wer baute das siebentorige Theben?“ fragte schon Bertold [sic] Brechts „lesender Arbeiter“. Die Quellen teilen uns nichts über diese anonymen Maurer mit, doch die Frage bleibt in ihrer ganzen Bedeutungsschwere stehen.2
Das ist der Ethos der Mikrogeschichte und auch der „Minor Histories“ und des Screening-Programms, bei denen es jeweils darum geht, das Nebensächliche und das Sekundäre in den Vordergrund zu stellen und so verschiedene historische Neubetrachtungen zu ermöglichen.
Wenn ich auch im Weiteren die Begriffe „nebensächlich“ und „sekundär“ verwende, beabsichtige ich durch diese nominale Klassifizierung keineswegs die Bekräftigung einer Werthierarchie, die solche Materialien einem Hauptprojekt, was auch immer sich dahinter verbergen mag, unterordnet. Hinter diesem Screening-Programm steht die Absicht, den Wert der Auseinandersetzung mit dem bzw. in dem Sekundären oder Nebensächlichen zu beleuchten, um genau das zum zentralen Thema und Untersuchungsziel zu machen, trotz der Diskreditierung des entsprechend eingeordneten Materials. Die Begrifflichkeiten sind ohnehin immer relativ.
In dieser Programmreihe werden die im Portikus gezeigten Ausstellungen und deren einzelne Kunstwerke zur „Hauptsache“. Das, was außerhalb davon liegt (z.B. die anderen Kunstwerke der Künstler, die Programmelemente, die anderswo in den Räumlichkeiten der Institution stattfinden, und die Veranstaltungen, die sich den üblichen zeitlichen Rahmenbedingungen der Ausstellung entziehen), wird zur Nebensache oder sekundär.
Helke Bayrles aktuelles Videoprojekt, Portikus Under Construction (1992 bis zur Gegenwart) arbeitet mit der Inszenierung kurioser Paradoxa nach eben diesem Schema. Ihre Videos zeigen die Arbeiten im Portikus vor der Ausstellungseröffnung – wie Gerüste auf- und wieder abgebaut, Kunstwerke eingepackt und Pläne durchgeführt oder verändert werden, wenn irgendwelche unvorhergesehenen Schwierigkeiten auftreten. Obwohl all diese Vorkommnisse und Vorgänge von grundlegender Bedeutung für die Inszenierung einer Ausstellungen in der Galerie sind, spielen sie bei der Präsentation der Kunstwerke am Ende doch nur eine Nebenrolle. Über Bayrles Projekt schreibt Kirsty Bell:
Helke Bayrle richtet ihr Augenmerk auf die Details am Rande, auf unscheinbare Gesten, auf banale Vorgänge, um genau diese Aspekte des kreativen Prozesses zu erfassen: die Dinge, „die als selbstverständlich hingenommen werden, es aber nicht sind.3
Helke Bayrle, Portikus Under Construction (Frances Stark), 2008.
Doch werden diese Dinge wirklich als Selbstverständlichkeit hingenommen, weil sie fraglos banal und nebensächlich sind? Was hat sie ins Abseits und in die Banalität gedrängt? Die reine Notwendigkeit einer Handlung macht sie nicht banal. Auch bei dem, was als Normal gilt, gibt es Spielräume. In den meisten Fällen bleiben die im Vorfeld einer Ausstellung geleisteten („banalen“) Arbeiten trotz ihrer Notwendigkeit im Endergebnis, das den Ansprüchen einer Eröffnung genügt, unsichtbar. Damit möchte ich nicht sagen, dass alle Kunstausstellungen die Arbeiten und die am Aufbau beteiligten Arbeiter gezielt in den Hintergrund drängen, sondern vielmehr darauf hinweisen, dass die betreffende Arbeit (Kunst?) in der Regel nicht sichtbar ist. Bayrles Werk bereitet dem, was unsichtbar ist, eine Bühne, um es neu sichtbar zu machen, wobei die „sekundären“ Vorgänge wieder in das Hauptkunstwerk eingewoben werden. Das vermeintlich „Banale“ wird nicht mit einem Schulterzucken abgetan oder versteckt. Seine Banalität wird in Frage gestellt. Die Nebensache wird zur Hauptsache.
Mit nur einer Ausnahme (Bayrle) wurden diese Filme und Videos noch nie im Rahmen einer Ausstellung im Portikus gezeigt, doch nun wurden sie für ein Filmprogramm aus Anlass des 30-jährigen Jubiläums der Institution zusammengestellt. Man könnte meinen, ein Anlass dieser Art könne als Gelegenheit dienen, die Geschichte einer Institution nachzuzeichnen. Was für eine Art von Geschichte wird durch eine Zusammenstellung von Einzelteilen konstruiert, die nur am Rande mit dem Programm der Vergangenheit zu tun haben? Könnte es eine nebensächliche Geschichte sein? Es wäre doch etwas übertrieben, die Filme und Videos in einem solchen thematischen Rahmen zu präsentieren, wenn sie nur aufgrund der Tatsache, dass sie nicht gezeigt wurden, nebensächlich oder sekundär wären.
Es ist aber so, dass sie ihre Berechtigung, über und aus dieser Perspektive zu berichten, nicht einfach nur aus ihrer Nichtberücksichtigung in den Programmen der Vergangenheit ziehen. Durch formale Methoden, die mit dem Spannungsfeld zwischen dem Verborgenen und dem Offenbaren spielen, didaktische Hinweise auf Nichtgezeigtes und das Umgehen einer gefälschten Klarheit durch Übermaß oder Auslassung nähern sich diese Videos und Filme dem Material von unten und von der Seite und stellen Vorgänge, die zur Nebensache gemacht wurden, in ein neues Licht.
Der erste Programmabschnitt steht unter dem Titel „Filming Lack“. Im Mittelpunkt steht das Video „Corpse Cleaner“ (2016) von Thirteen Black Cats, einem Kollektiv für Bewegtbilder.4 „Corpse Cleaner” rückt das, was sonst nicht sichtbar wird, ins Blickfeld: geheime Briefwechsel, die Produktion von Hollywood-Filmen, Atomtechnik. In einer langen Aufnahmesequenz, die sich durch ein Requisitenlager schlängelt, das die vergessene Infrastruktur einer finanzschweren Filmproduktion beherbergt, werden alle drei Themen miteinander verwoben, wobei die Atomtechnik den Dreh- und Angelpunkt bildet. Thirteen Black Cats präsentiert das Video im Negativ und verwendet Impressionen und Folgeeffekte, um den Widerstand der Atomtechnik gegen saubere und eigenständige Bilder zu registrieren. Sowohl in Form als auch Inhalt nähert es sich gravierenden Ereignissen (der Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki durch das amerikanische Militär) durch das Randständige und Nebensächliche.

Thirteen Black Cats, Corpse Cleaner, 2016, Mit freundlicher Genehmigung der Künstler.
Den Abschluss des Filmprogramms bildet Morgan Fishers Film Standard Gauge (1984), der im Programmabschnitt „Non-work“ gezeigt wird. Fisher zieht sein gesammeltes 35-mm-Filmmaterial über einen Leuchtkasten, kommentiert die einzelnen Bilder und erzählt die Hintergrundgeschichten zu der Arbeit und der Produktion, was letztlich die Bilder ergibt, die wir auf Film gebannt sehen. Seine Kommentierung bringt das ins Wort, was im fertigen Hollywood-Film, der frei von allen Fehlern und chaotischen Umständen bei der Produktion auf der Kinoleinwand gezeigt wird, im Verborgenen bleibt. Labortechniker, Filmvorführer und anonyme Frauen, die zum Kalibrieren der Filmfarbe eingesetzt werden, werden allesamt in ein Endprodukt hineingenommen, das sonst meist alle Spuren ihrer Arbeit auslöscht.

Morgan Fisher, Standard Gauge, 1984, 16-mm, Farbe, Lichtton, 35 min., Mit freundlicher Genehmigung der Galerie Buchholz, Berlin/Köln/New York.
Das zwischen Standard Gauge und Corpse Cleaner aufgespannte Sommerfilmprogramm versucht, seinem Anfangs- und Endpunkt treu zu bleiben, ebenso wie auch dem Impuls zu einer Neubetrachtung des Nebensächlichen, das Helke Bayrle in den Mittelpunkt einer Entfaltungsgeschichte des Portikus stellt. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Institution, das unter dem Motto Portikus XXX stadtweit mit Installationen, Veranstaltungen und Lesungen begangen wird, versucht das Programm Summer Screenings, markante Ereignisse der Vergangenheit aus der unteren und der rückseitigen, der nebensächlichen und der sekundären Perspektive zu beleuchten.
Übersetzung aus dem Englischen: Angela Selter
Klicken Sie hier für das vollständige Summer Screening Programm (PDF)
Seit Ende des 19. Jahrhunderts wacht die Statue of Liberty vor der Küste New Yorks über die Freiheit und deren Einhaltung im Land. Verschifft wurde die kolossale Statue in Einzelteilen von Europa aus nach Amerika. Sowohl die Freiheitsstatue als auch die geschriebene Verfassung aus dem 18. Jahrhundert, die die Lady of Liberty, wie sie umgangssprachlich genannt wird, in den Händen hält, verkörpern und symbolisieren einen westlichen Freiheitsgedanken, der bis heute Gültigkeit besitzt. Dieser beinhaltet unter anderem die Freiheit eines Einzelnen die eigene Meinung in Wort, Schrift und Bild zu äußern, rechtlich gesichert in einer Verfassung. In Deutschland ist zum Beispiel die Freiheit auf Meinungsäußerung im Artikel 5 des Grundgesetzes verankert. Heutzutage ist dies mehr denn je ein essentielles und zu schützendes Recht, das jedoch immer wieder an seine Grenzen gerät.

Danh Vo, WE THE PEOPLE, 2011, Kupfer, 223 × 155 × 107 cm, Kadist Sammlung, Foto: Helena Schlichting
Ein wichtiges Merkmal einer demokratischen Gesellschaft ist eine friedliche Auseinandersetzung und ein Dialog zwischen konträren Meinungen. In den letzten Jahren zeigen sich jedoch politische Tendenzen, die eine freie Meinungsäußerung deutlich einschränken. Dies findet in europäischen Demokratien statt, aber auch weltweit erstarken politische Stimmen, die gegen tolerante Gesellschaften laut werden. So zeigt sich beispielsweise in der Türkei eine deutliche Einschränkung der Pressefreiheit. Regierungskritische türkische Journalisten werden in Haft genommen, eine freie Meinungsäußerung scheint nicht mehr möglich zu sein. Ein offen geführter und kritischer Dialog und Toleranz gegenüber konträren Meinungen ist für ein gemeinsames Zusammenleben jedoch essentiell. Dieser Dialog kann über die Medien oder mit den Mitteln der Kunst angestoßen und geführt werden. So zeigt beispielsweise Danh Vo, der im Alter von vier Jahren mit seiner Familie aus Vietnam nach Dänemark floh, mit seinem Werk WE THE PEOPLE Teile der amerikanischen Statue of Liberty. Danh Vo rekonstruiert mit seiner Arbeit einzelne Elemente der damaligen in Einzelteilen verschifften Statue nach und zeigt diese nie als ganzes, sondern fragmentarisch zerlegt. Insgesamt 225 Elemente aus Kupfer ließ der Künstler als exakte Replik der Freiheitsstaue produzieren. Die monumentale Skulptur wird dadurch abstrahiert, das Symbol für welches sie steht wirkt wie zerbrochen. Die Auseinandersetzung Danh Vos mit der Statue of Liberty und deren Bedeutung findet in seinem Werk WE THE PEOPLE auf verschiedenen Ebenen statt. Zum einen greift der Künstler direkt eines der Symbole für Freiheit auf, zum anderen bezieht sich der Titel der Arbeit auf die ersten drei Worte der Präambel der amerikanischen Verfassung aus dem 18. Jahrhundert. Danh Vo reflektiert mit seiner Arbeit WE THE PEOPLE auf simple Weise über das Konzept Freiheit und zeigt mit den nicht zusammengefügten Einzelteilen, wie fragil Freiheit ist und obwohl wir sie als selbstverständlich ansehen, geschützt und bewahrt werden muss.

Danh Vo, WE THE PEOPLE, 2011, Kupfer, 223 × 155 × 107 cm, Kadist Sammlung, Foto: Helena Schlichting
Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit stellen unter anderem die fundamentalen Säulen einer demokratischen Gesellschaft dar. Die amerikanische Philosophin Judith Butler formuliert in ihrem Buch Anmerkungen zu einer performativen Theorie der Versammlung, wie Versammlungsfreiheit ein entscheidendes Merkmal einer Volkssouveränität darstellt.1 Laut der Autorin stellt das Recht sich frei als Gruppe zu versammeln, eine Grundvoraussetzung der Politik dar und darf nicht von Regierungen eingeschränkt werden.2 Die Menschen müssen das Recht haben, sich frei zu versammeln, jederzeit einfordern können. Die Formulierung „We the people“, die sowohl der Titel der Arbeit Danh Vos, als auch die einleitenden Worte der amerikanischen Verfassung wiedergeben, wird immer wieder von sich versammelten Gruppen aufgegriffen. Jedoch kann eine versammelte Gruppe, die behauptet „We the people“ also „das Volk“ zu sein, laut Judith Butler nicht existieren, da diese nur einen bestimmten Ausschnitt eines Volkes nachbilden kann. Ebenso stehen die Teile der Arbeit WE THE PEOPLE von Danh Vo, die nie als Ganzes zusammengefügt werden, sondern nur als Einzelstücke in Ausstellungen präsentiert werden, in ihrer Ausschnitthaftigkeit für ein größeres Ganzes und gleichzeitig für die vielen unterschiedlichen Menschen und Gruppen in unserer Gesellschaft.
Anlässlich Amy Sillmans Ausstellung the ALL-OVER im Portikus spricht Bernard Vienat im Interview mit der Künstlerin über ihre Anfänge und ihre künstlerische Praxis.
BERNARD VIENAT: Deine Karriere nahm ihren Anfang in den 1970er Jahren, zu einer Zeit als John Baldessari seine Malereien verbrannte. Man begegnete diesem Medium damals sicherlich mit Vorbehalt. Wie hast du dich dem Problem des künstlerischen Überlebens gestellt?
AMY SILLMAN: In den 1970er Jahren hatte ich keine “Karriere”, ich ging erst 1979 von der Schule ab. Und Gedanken an eine berufliche “Karriere” wären damals gar nicht bei uns aufgekommen. Ich habe tagsüber gejobbt, um das Überleben zu sichern: In den 80ern arbeitete ich bei einigen Zeitschriften, dort übernahm ich die sogenannten “paste ups”, d.h. wir fixierten die Bilder und den Drucksatz mit Wachs. Ich war zwar keine Punkerin mit Iro, war aber dennoch von einem punkartigen Ethos erfüllt. Vieles von dem, was ich tat, war hintergründig von einer “Fuck you” Einstellung bestimmt. Wie zum Beispiel: “Ich soll nicht mehr malen? Fuck you!”, “Ich soll mich um Ruhm und Ansehen bemühen? Fuck you!” Negation war bei mir so eine Art Prinzip. Das war das Ethos der Zeit und ich habe weitergemalt, als eine Art lustbringende Verkehrung dessen, was von uns erwartet wurde.
VIENAT: Wie kam dir erstmals der Gedanke Künstlerin werden zu wollen? Und das im Bereich der Malerei?
SILLMAN: Ich ging nicht nach New York um künstlerisch tätig zu werden, sondern um an der New York University japanisch zu studieren. Ich hatte eine wilde Reise durch Japan hinter mir und mein Interesse war geweckt, eine fremde Sprache zu studieren und zwar eine Sprache, die den meisten meiner Bekannten unentzifferbar wäre. Ich war von der Vorstellung angezogen, kodiert schreiben zu können, darum habe ich japanisch studiert. Nebenher habe ich Zeichenunterricht genommen. Der Lehrer war ein “action painter“ (dt. Aktionsmaler), der während des Unterrichts tatsächlich Jazzmusik spielte und uns lehrte, wie man ein Aktmodell betrachtet, es dann aber mit Terpentin getränkten Lappen zu zeichnen. Bei dieser Lehrveranstaltung kam mir plötzlich der Gedanke: “Mein Gott, das ist ja auch eine Art von kodierter Sprache!” So etwas war mir anfänglich nicht aufgefallen, weil mir Vorbilder fehlten, die es mir erlaubten, mich als Künstlerin zu erkennen. Ich kam also auf Umwegen mit dem Pinsel in der Hand auf diesen Weg.
VIENAT: An welchen weiteren Lehrveranstaltungen hast du danach teilgenommen?
SILLMAN: Neben dem “Aktionsmaler” gab es all diese für die 70er Jahre typischen Figuren: FeministInnen, KonzeptkünstlerInnen, FilmemacherInnen und KünstlerInnen, die das Arbeiten im Atelier ablehnten. Ungefähr 95% meiner Freunde hatten der Malerei den Rücken gekehrt, weil die Malerei eine schlechte Politik zu verkörpern schien. Die Neo-Expressionistische Kritik war in vollem Gange. Meine Freunde besuchten allesamt Lehrveranstaltungen von Joseph Kosuth oder Hans Haacke. Zu malen galt als überhaupt nicht angebracht, ich habe mich trotzdem dazu hingezogen gefühlt.
VIENAT: Deine Karriere begann, nachdem bedeutsame TheoretikerInnen die Malerei und die Art und Weise sie zu betrachten, behandelt hatten. Wie war deine Reaktion zum Beispiel auf Greenbergs Theorien? Wir sprachen ja vorhin vom Punkethos, dachtest du dir dann nicht: Mein Vater will es so, deshalb bin ich dagegen?
SILLMAN: Aber Greenberg war ja nicht mein Vater! Wenn überhaupt war er so etwas wie ein Großvater. Ich kannte damals niemanden, der Greenberg las und ich selbst verstand auch wenig von den Konflikten und Auseinandersetzungen innerhalb der Kunstgeschichte. Sein Artikel zu Kitsch und der Avantgarde hat mich durchaus interessiert. Generell betrachtet, haben wir in den 70ern kaum etwas zur Maltheorie gelesen. Malerei war ein totgeborenes Unterfangen. Ich habe das jemandem mal beschrieben als das Besetzen eines verfallenen Gebäudes. Meine Ideen stammten allesamt von woanders: Tanz, Performance, Experimentalfilm, und Literatur. Ich konnte gar nicht in dem System Malerei arbeiten, weder in dem von OCTOBER noch in dem von Greenberg.

Amy Sillman, Draft of a Voice-over for Split Screen Video Loop, in Zusammenarbeit mit Lisa Robertson, Ausstellungsansicht, 12.05.–28.06.2012, castillo/corrales, Paris
VIENAT: Wie hast du angefangen mit digitalen Medien zu arbeiten?
SILLMAN: Ich erhielt ein iPhone und dadurch endlich eine brauchbare Kamera. Ich war zu dem Zeitpunkt für eine Kollaboration mit dem Dichter Charles Bernstein nach New York City eingeladen worden. Ich kenne viele Dichter und bin an der Erweiterung von Sprache interessiert. Unsere Arbeit bestand darin, einander E-Mails zu senden. Meine bestanden aus Zeichnungen, die ich auch auf dem iPhone gemacht hatte, er wiederum erweiterte diese mit neuen Gedichtsfassungen, sodass wir uns wechselseitig beeinflussten. Danach erhielt ich eine Einladung zu einem Projekt am Castillo Corrales in Paris: Ich schlug vor, eine Zeichentrick-Animation in Zusammenarbeit mit einer befreundeten Dichterin namens Lisa Robertson zu machen.
VIENAT: Forschst du noch weiter in diese Richtung oder ist diese Schaffensphase nun vorbei?
SILLMAN: Ich mache damit weiter. Ich liebe das Malen von der praktischen Seite her, habe allerdings zuletzt erkannt, dass ich wie eine KonzeptkünstlerIn denke, wenngleich wie eine, die auf physischer Grundlage und etwas irrational vorgeht. Ich bringe auf einer rechteckigen Fläche Sprache und Raum ebenso ein wie Malerei. Das iPhone half mir in meiner Praxis ganz neue Wege zu erschließen, das war schon sehr befreiend.
VIENAT: Der New Yorker Psychoanalytiker David Lichtenstein schreibt über deine Arbeiten und den Gedanken des “Ursprungs”. Dabei benennt er auch den psychoanalytischen Moment, in dem das Objekt entsteht. Wenn wir uns an dieser Stelle auf Lacan beziehen: Befindest du dich beim Malen in einem Zustand der Besorgnis? Wie ist deine Gemütslage beim Malen?
SILLMAN: Zur Hälfte besteht sie aus Enthusiasmus und freudiger Aufgeregtheit, einer Offenheit zu dem, was dabei herauskommen könnte. Die andere Hälfte ist das Grauen. Es ist tatsächlich beides. Ich las vor kurzer Zeit, dass es in der Psychoanalyse als “granular” [d.h. als ausdifferenziert] bezeichnet wird über ein vollständiges, präzises Spektrum der Gemütslagen zu verfügen. Das Wort gefällt mir sehr. Dieses Spektrum der Gemütslagen wird ja zum Beispiel in meiner Farbpalette sichtbar. Ich verwende eine Mischung aus “readymade” Farben, direkt aus der Tube, sehr leuchtende, stechende und klare Farben wie Kadmium Rot oder Zitronengelb, ungemischt, und kombiniere sie mit schlammigen, erdigen Farben, die von den darunterliegenden gemalten Schichten, die nicht gelungen waren, abgekratzt wurden. Diese Farben tropfen tatsächlich über Monate hinweg in einen Eimer. Sie werden sehr dreckig und nehmen kotartige, schlammige Farben an… und ich erkannte, dass es die Farbe von Schatten, Schmutz, Staub und Tod ist. Diese kombinierte Art der Palette gefällt mir sehr: Dreckige, besorgniserregende, ganz und gar unschöne Farben neben frischen, knallbunten, konzentrierten Farben direkt aus dem Regal. Ich kann mir vorstellen, dass ein Psychoanalytiker meine Gemütslage beim Malen als “granular” bezeichnen würde!
VIENAT: Wenn wir deine Gemälde als einen ganzen psychoanalytischen Prozess betrachten, handelt es sich hier um einen empirischen Prozess, in dem du archetypische Elemente herausarbeitest?
SILLMAN: Das klingt zwar sehr schön, hat aber mit meiner Arbeitsweise nichts zu tun. Ganz so reibungslos verläuft eine Psychoanalyse ja auch nicht. Es wäre eventuell noch möglich vom Malen als empirischen Vorgang zu sprechen, weil es von der Erfahrung angetrieben wird. Es führt mit Sicherheit aber nicht zu Archetypen. Das von mir bearbeitete psychologische Terrain ist ein absurdes und es ist besetzt von Konflikten und unlösbaren und nicht benennbaren Ausbrüchen. Das führt nicht notwendigerweise zu Erkenntnis oder Bedeutung. Es geht auch nicht um eine universelle Wahrheit.
VIENAT: Auf deinen Bildern gibt es viel Innenraum. Geht es hier um die Beobachtung deines eigenen Ateliers oder eher um introspektive Vorgänge?
SILLMAN: Das Atelier ist dieser grässliche Raum, in dem wir den ganzen Tag lang sind, zumeist allein, zumindest jene unter uns, die ein Atelier haben, trotzdem betrachten wir alle sehr aufmerksam die Welt da draußen und was ich dort sehe, geht in die Erinnerung über. Deshalb glaube ich, dass die Räumlichkeit eines Bildes wirklich eine Art von Raum ist und nicht nur eine “Abbildung”. Bilder gehen von außen nach innen UND von innen nach außen. Meine Vorstellung von Innerlichkeit ist wahrscheinlich gleichermaßen von beidem bestimmt. Das Atelier wurde als eine Art bürgerlicher Innerlichkeit kritisiert, aber sicherlich gibt es im Atelier auch nicht mehr Innerlichkeit als wenn man gerade Radio hört. Die Welt dringt in uns und aus uns allen.
VIENAT: Was bedeutet es für dich, Abstraktion zu verstehen?
SILLMAN: Ich bin mit ihrer Sprache vertraut. Wenn ich ins Museum gehe, bin ich von Form, Farbe, Linie, Transparenz, Maßstab, Undurchsichtigkeit, Schichten, Markierung, Gestik und Kante nicht verwirrt. Ich kenne mich damit aus, in dieses Fahrzeug einzusteigen und damit herum zu fahren.
VIENAT: Anhand welcher Kriterien würdest du eine abstrakte Malerei beurteilen?
SILLMAN: Abstraktion ist die “Form des Inhalts”, es ist eine Form, die ermöglicht Bedeutung freizusetzen oder Bedeutung zu schaffen. Form sollte nicht dekorativen oder imitierenden Zwecken dienen. Meinem Verständnis nach ist die Abstraktion eine Art und Weise eine hybride Sprache zu entwerfen, mittels eines Codes oder mit einer fremden Stimme zu sprechen. Ein Aspekt meiner Kriterien wäre demnach: Trägt diese Abstraktion zu Fremdheit, Überraschung und dem Gefühl von Neugier, Enthusiasmus, Freiheit bei, einem Bruch mit der unterdrückerischen Ordnung des schon Bestehenden? Bekommt man das Gefühl, dass sich hier eine Person äußert, eine Persönlichkeit, die etwas Neuartiges erkennen lässt? Liegt eine Gelassenheit, Strenge, Freiheit und Notwendigkeit vor, um dem zu entkommen, was schon vorgezeichnet worden ist? Wenn das der Fall ist, war es meines Erachtens eine gelungene Anwendung von Abstraktion.
VIENAT: Zur Zeit kann man unter KünstlerInnen einen Trend beobachten, wie beispielsweise auf der laufenden Berlin Biennale, dass die Gegenwart eins zu eins gespiegelt wird, anstatt Feinheiten herauszuarbeiten. Welche Rolle spielt die Poesie in deiner Arbeit?
SILLMAN: Poesie ist mir sehr wichtig, dabei gefällt mir eher eine Poesie, die sich schräg stellt als eine mit Gebrauchswert. Es ist mehr ein Kommunikationssystem, das sich nicht ganz und gar dem Verzehr ausliefert. Es beleuchtet stattdessen eine Randzone, spielt mit dem Vokabular oder der Metrik, um präziser, geistreicher, perverser und intensiver als Herkömmliches zu sein. Ähnliches würde man sich ja auch erhoffen, wenn es darum ginge, ein “besseres” Bild zu malen.

Amy Sillman, the ALL-OVER, Ausstellungsansicht, 02.07.–04.09.2016, Portikus, Frankfurt/Main. Photo: Helena Schlichting. Courtesy: Portikus, Frankfurt/Main.
VIENAT: Was hast du für den Portikus entwickelt?
SILLMAN: Für den Portikus habe ich im Grunde eine Ausstellung gemacht, die aus wiederholschleifenartigen Mechanismen besteht: Wenn man eintritt, wird man von einer ein-minütigen Zeichentrick-Animation empfangen, die sich immer wieder wiederholt. Kleine Zeichentrickfiguren vollführen darin absurde Dinge, die Erzählhandlung ist linear. Danach betritt man einen großen Raum, in dem gedruckte und gemalte Leinwände stehen, die einmal rundherum gehen, ähnlich einem Fries. Aber die Gemälde sind eindeutig ausgehend von einer abstrakten Malsprache entstanden und unterscheiden sich von der Zeichentrickgeschichte. Bei dem Konzept geht es um die BetrachterInnen und die “Maschine” der Bewegung. Der Zeichentrickfilm bewegt sich von selbst, im Ausstellungsraum wiederum bewegen sich die BetrachterInnen vor den Gemälden und gehen an ihnen vorbei. Abgerundet wird alles mit dem Zine und dieser kleinen Keramikfigur, die ich als eine Art Münzautomat entworfen habe: Wenn man ein Zine mitnehmen möchte, wirft man eine Münze in den geöffneten Mund der Figur, diese scheidet sie dann durch eine Öffnung im Tisch wieder aus. Und dieser Vorgang verweist dann wieder zurück zu der Zeichentrick-Animation im Eingangsbereich. Ich versuche mich hier an einer komplizierten Maschinerie. Die Tafeln sind durch Tintendruckverfahren bedruckte Leinwände, auf die zudem Farbe aufgetragen wurde. Ihnen liegen einige meiner Zeichnungen zugrunde, dadurch wird die Unterscheidung zwischen maschinell und von Hand hergestellt erheblich erschwert. Der Farbvielfalt meiner anderen Werke ist hier etwas reduziert, um den Aspekt der schleifenartigen Wiederholung hervorzuheben. Die Drucke basieren auf meinen anderen Zeichnungen, hier allerdings in einem größeren Maßstab, entsprechend dem Format der Leinwand. Ich wollte den Raum gänzlich ausfüllen, dabei aber einige der üblichen Möglichkeiten der Malerei außer Acht lassen.

Amy Sillman, the ALL-OVER, Ausstellungsansicht, 02.07.–04.09.2016, Portikus, Frankfurt/Main. Photo: Helena Schlichting. Courtesy: Portikus, Frankfurt/Main.
VIENAT: Und bei der Zeichentrick-Animation?
SILLMAN: Der Zeichentrickfilm ist eine Art um sich über die klassischen Bestimmungen von Figur und Grund sowie Vorder- und Hintergrund in der Malerei lustig zu machen. In der Malerei bezeichnen diesen Begriffen die Unterscheidung zwischen dem “Subjekt” eines Bildes und dem Hintergrund. Der Begriff “Figur” kann sogar für die Darstellung durch einen abstrakten Pinselstrich genutzt werden, es muss sich gar nicht um eine tatsächliche Figur handeln. In dieser Arbeit wollte ich aber die Vorstellung einer Figur wortwörtlich in einer Art Scherz umsetzen. Mir fiel auf, dass all die Gemälde einen abstrakten Hintergrund haben, im Grunde sind sie so etwas wie eine Tapete. Daher lag es mir daran, eine wirkliche Figur hinzuzufügen. Aber wen? Ich hatte diesbezüglich keine Idee, bis ich mit meiner Klasse eine vom Unglück verfolgte Forschungsreise in die Schweiz unternahm auf der sich eine Reihe kleinerer und dazu noch komischer Unglücksfälle ereignete. Da ging mir ein Licht auf, das war meine Geschichte. Ich stellte eine Art Rube-Goldberg-Maschine her, ein Unglücksrad, das man eigentlich selber anwerfen muss, um es zu verstehen!
Übersetzung aus dem Englischen: Stefan Siemsen
Bernard Vienat studiert derzeit Curatorial Studies, ein Master Studiengang an der Staatlichen Hochschule für Bildende Künste – Städelschule und der Goethe Universität Frankfurt. Er studierte Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Bern und der Freien Universität Berlin. Vienat ist Gründer des Kunstvereins art-werk in Genf und leitet das Austauschprojekt mit Mexiko DF Vorticidad.
Ein Narrativ für den Körper: Present Sore von Shahryar Nashat

Shahryar Nashat, Present Sore, 2016, Video.
Eine der neusten Arbeiten des Künstlers Shahryar Nashat ist Present Sore (2016), ein zusammengesetztes Porträt des Körpers im 21. Jahrhundert, der durch organische ebenso wie künstliche Substanzen vermittelt wird. Im folgenden Interview sprechen Isla Leaver-Yap, Walker-Bentson-Filmwissenschaftlerin, und Fabian Schöneich, Kurator des Portikus, mit Nashat darüber, was seine Arbeit antreibt – die Politik des Körpers, dessen digitale und physische Erweiterungen und seine Obsoleszenz.
Present Sore wird vom 8. April bis 31. Mai 2016 im Rahmen der Walker’s Moving Image Commissions online im Walker Channel präsentiert. Außerdem ist die Arbeit in der Ausstellung Model Malady im Portikus (23. April–19. Juni 2016) zu sehen.
FABIAN SCHÖNEICH: Deine neuste Videoarbeit Present Sore wird online auf dem Walker Channel gestreamt sowie in deiner Ausstellung im Portikus als Installation gezeigt. Die Arbeit hat ein vertikales Format, 9:16 statt 16:9. Das erinnert mich daran, wie die Leute Videos mit ihren Smartphones machen. Kannst du sagen, was dich zu deiner Entscheidung geführt hat, die Kamera zu drehen?
SHAHRYAR NASHAT: Das stimmt – durch Smartphones ist die Verwendung des Hochformats allgemein üblich geworden. Als ich für meine erste Ortsbesichtigung den Portikus besuchte und die Räume sah, erkannte ich sofort, dass ein Video im 16:9-Format durch die Höhe der Räume erdrückt werden würde. Darüber hinaus habe ich immer Schwierigkeiten mit dem Format 16:9 gehabt, weil man das Bild nie ausfüllen kann, wenn man Gliedmaßen vertikal einfangen will. Present Sore ist eine indirekte hochauflösende Figurenstudie eines zusammengesetzten Körpers. Der Aufwärtsverlauf des Videos (von den Füßen zum Kopf) machte das Hochformat notwendig.
SCHÖNEICH: Deine Arbeit befragt und beleuchtet häufig die Homogenität von Objekt und Körper. Abstrakte, aber sterile Objekte stehen repräsentativ für den Körper oder umgekehrt, der Körper steht repräsentativ für das Objekt oder die Skulptur. In Present Sore sehen wir den menschlichen Körper nicht als Ganzes, sondern nur im Detail – etwa in der Nahaufnahme eines Knies oder einer Hand.
ISLA LEAVER-YAP: Absolut. Indem sich Present Sore auf Details konzentriert, fragmentiert es das Subjekt, zeigt die mechanischen beweglichen „Teile“ des Körpers und isoliert deren Funktion als Werkzeuge. Diese Fragmentierung bezieht eine umfassendere kulturelle Landschaft ein, die bestimmte Arten von Körpern bevorzugt, und verweist auch auf eine ökonomische Landschaft, die die Bestandteile der Arbeit unsichtbar macht – sowohl die menschlichen wie die nicht-menschlichen. Ich habe mich gefragt, Shahryar, ob du etwas über diese Eigenschaft des „Zusammengesetztseins“ sagen könntest, über die du eben gesprochen hast, und über die Körper, Typen und Gender, die du zu deinen Sujets machst?
NASHAT: Die vorherrschende kulturelle Repräsentation des menschlichen Körpers privilegiert einen homogenen und ganzheitlichen Körper. Ich habe immer versucht, Körper darzustellen, die sich außerhalb dieser traditionellen Ideale befinden. Die Körper, für die ich mich interessiere, können verschiedene motorische Funktionen haben, kosmetische Eingriffe und Erweiterungen. Wie etwa der verletzte Ellbogen in Hustle in Hand (2014, Video, 19 Min.). Aus diesem Grund mag ich Wunden oder Prothesen. Sie verweisen auf Verletzungen und insofern auf eine Anomalie. Auch Gliedmaßen sind auf ähnliche Weise interessant. Vom Rest des Körpers isoliert, hinterfragen sie ihn und erlauben zugleich eine psychologische Distanz zu der Vorstellung der Person. Hier eröffnet sich für mich ein Weg zur Begierde und zur Projektion.

Shahryar Nashat, Hustle in Hand, 2014, HD video, 10 minutes
Courtesy Rodeo, London; Silberkuppe, Berlin.
LEAVER-YAP: Was meinst du mit „Wunsch“ und „Projektion“? Besonders in diesen beiden Begriffen scheint mitzuschwingen, wie deine Arbeit sich mit Vorstellungen der Queerness überkreuzt. Deine Arbeit verwischt die Grenzen zwischen Fetisch und Werkzeug und bedient sich häufig promisker formaler Beziehungen; damit meine ich Dinge, die dem ähneln oder für es „einstehen“, was sie repräsentieren, aber diese Repräsentation auch komplexer machen: ein Hochformat als Körper, ein Kunstwerk von Paul Thek mit einem verrottenden Stück Fleisch für eine psychische menschliche Wunde oder eine künstliche Prothese als ideales Werkzeug des Körpers im 21. Jahrhundert.
NASHAT: Ich denke, die Kunst hat immer mit den Mechanismen von Wunsch und Projektion gearbeitet. Nicht nur als Ansporn für den Künstler selbst, sondern auch in der Art und Weise, wie seine Arbeit vom Publikum anerkannt und konsumiert wird. Das „Einstehen“ ist eine kraftvolle Strategie, weil es mittels Täuschung funktioniert, was eine weitere kraftvolles Charakteristik ist. Das klingt alles sehr theoretisch, was ich damit aber vermutlich sagen will, ist, dass die Frustration der Bedeutung für jede Arbeit zentral ist, weil sie Begehren erweckt. Die Werkzeuge, die ich in meiner Arbeit nutze – Rahmungen, Bearbeitungen, ein geometrisches Objekt neben der Nahaufnahme einer Wunde – sind Teil dieses Unterfangens.
SCHÖNEICH: Definiert Unvollkommenheit für dich Begierde?
NASHAT: „Vollkommen“ im Gegensatz zu „unvollkommen“ klingt wie „gut“ im Gegensatz zu „schlecht“. Ich glaube nicht, dass es um Moral geht. Wenn ich mir etwa einen Film oder eine Fernsehsendung anschaue, sind die interessanten Figuren nicht unbedingt diejenigen, deren Persönlichkeit mit einem Makel behaftet ist oder die widersprüchlich agieren. Mir ist es egal, ob es gute oder schlechte Menschen sind. Aber es gefällt mir, wenn ihnen eine Perversion eigen ist, eine Art von Widersprüchlichkeit. Inkohärenz schafft eine überzeugende und komplexe Figur. Das ist Begierde.
SCHÖNEICH: Wie wichtig ist für dich in dieser Arbeit die Geste? Ich denke insbesondere an die Teile von Present Sore, in denen an einer Lippe gezogen wird oder ein Ohr berührt oder zugehalten wird.
NASHAT: Einen Körper aufzunehmen, der unbelebt ist oder in einer Aktion eingefroren, hat in den 1990er Jahren Sinn ergeben, als die Fotografie damit beschäftigt war, Tableaux vivants zu schaffen. Für mich hingegen ist der Körper in Aktion interessanter, weil er nicht nur für die Kamera „ausgestellt“ wird, um die beste Aufnahme zu erlangen. Er konkurriert mit der Kamera und zwingt sie, andere Strategien zu finden. Es ist weniger manieriert als etwa eine Pose, und die formale und ästhetische Geste ergibt sich nicht aus dem, was man betrachtet, sondern aus der Art und Weise, wie man es betrachtet. Wenn man den Körper mit Handlungen und Gesten versieht, beschreibt man ein Narrativ für diesen Körper. Man verleiht ihm Handlungsmacht. Ich muss jedoch sagen, dass der Körper auch auf sehr aktive Weise passiv sein kann – wie etwa ein Rauchender oder ein Schlafender, was gleichermaßen machtvolle Bilder sind.

Shahryar Nashat, Present Sore, 2016, Video.
SCHÖNEICH: Wie hast du Present Sore gefilmt? Kannst du etwas zu der Überlagerung der Bilder im gesamten Video sagen?
NASHAT: Die Überlagerung entstand aus einem Zufall, den ich letztlich beibehalten habe. In letzter Zeit habe ich mir häufig Software-Bugs und meine eigenen technischen Fehler zunutze gemacht.
LEAVER-YAP: Deine Arbeit ist so sorgfältig choreografiert und geschnitten, dass es wirklich interessant ist, von der Bedeutung des Zufalls in deiner Arbeit zu hören. Der Zufall scheint mir eine so menschliche Eigenschaft zu sein, während die Aufmerksamkeit für den Zufall etwas sehr Digitales ist – die Eigenschaft, beobachtet oder überwacht zu werden. Mich hat frappiert, was Moyra Davey mir letztes Jahr über das Filmen mit Video berichtet hat. Moyra macht meistens Analogfotografien, und jetzt dreht sie Digitalvideos. Sie sagte mir, dass ihr gefalle, wie Video auf eine für die Form spezifische Weise „den Zufall festhält“. Das Digitale fängt physische Verwundbarkeiten ein, ebenso wie es in der Postproduktion genau diese Eigenschaften vergrößern oder tilgen kann. Ich habe mich gefragt, ob du etwas über die Idee des Fehlers, des Versehens und des Zufalls in deiner Arbeit sagen könntest?
NASHAT: In Hustle in Hand unterbrach mein Schnittprogramm die Videowiedergabe. Ein Bild aus einem völlig anderen Teil des Videos drängte sich in den Clip. Ich nutzte diesen Fehler schließlich, weil dadurch das lineare Narrativ der Zeitleiste aufgebrochen wurde – es ist wie eine Vorschau auf Aufnahmen, die noch kommen werden. Bei Present Sore wiederum brachte ich Material in einer falschen Auflösung in das Projekt, entschied mich dann aber, dies beizubehalten, da es den Blick auf den Körper komplexer machte. Gliedmaßen aufzunehmen ist ein solch gewöhnliches Bild. Man bedarf dieser Tricks, um die Aufmerksamkeit zu steigern. Technische Zufälle machen die Arbeit verwundbarer. Wenn man sie beibehält, kann man sie natürlich als normal erscheinen lassen, aber ich halte es für nützlich, wenn sie als Anomalien bestehen bleiben, die dem Werk zugute kommen.

Shahryar Nashat, Factor Green, Ausstellungsansicht, 54th International Venice Biennial, 2011
Courtesy Rodeo, London; Silberkuppe, Berlin. Foto: Gaëtan Malaparte.
SCHÖNEICH: Bereits in deinen frühen Arbeiten, wie etwa in Factor Green (2011) oder in deiner Ausstellung im Museum Folkwang in Essen, hast du dich mit der Bedeutung und der visuellen Präsenz des Sockels oder des Podests beschäftigt. Im Portikus und in der kommenden Ausstellung Question the Wall Itself im Walker Art Center präsentierst du eine Reihe von Skulpturen – Sockelblöcke –, die auf Stühlen platziert sind, von denen du sagst, dass sie dazu dienen, damit die Sockel sich darauf „ausruhen“ können.
NASHAT: Ja, der Sockel ist für das Kunstwerk, was der Fuß für den Körper ist. Er bietet die Unterstützung, die es dem Kunstwerk erlaubt, zu stehen und zu sehen zu sein. Er ist wie ein Paar Krücken. Present Sore spielt mit der Tatsache, dass hochauflösende Bilder heute im Dienst der „Unterstützung“ des Körpers stehen. Sie machen den Sockel überflüssig. „Chômage technique“ ist ein Ausdruck aus dem Französischen, der verwendet wird, wenn etwa Arbeiter in einer Fabrik auf Kurzarbeit gesetzt, ihre Löhne aber weiter gezahlt werden. In einer Welt von Körpern, die in Pixeln gezeigt werden, sind Sockel in einer Art „chômage technique“ – sie haben niemanden mehr zu stützen. In meiner Installation können sie sich zur Ruhe setzen und den Anblick der Körper genießen, die sie einst gestützt haben. Der Sockel war immer ein Benachteiligter, stand im Dienste von etwas anderem. In dieser Konfiguration aber ist es, als ob er im Lotto gewonnen hätte und sich in Florida zur Ruhe setzen würde.
Übersetzung: Robert Schlicht
Menschen stehen unter dem schattenspendenden Vordach einer Tankstelle. Dunkler Rauch steigt auf. Ein junger Mann kreist mit einer Steinschleuder über seinem Kopf. Es ist der 15. Mai 2014 um 13.45 Uhr im Westjordanland. Ein Mann mit Rucksack läuft ins Bild. Wenige Sekunden später trifft ihn von hinten eine Kugel. Er fällt zu Boden. Helfer stürmen herbei. Es ist der 15. Mai 2014 um 14.58 Uhr. Noch mehr grauer Rauch strömt auf. Von rechts läuft ein Mann ins Bild. Er wird in die Brust getroffen und fällt zu Boden. Helfer eilen herbei. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen die Morde an Nadim Siam Nawara, 17 Jahre, und Mohammad Mahmud Odeh Abu Daher, 16 Jahre, die sich während der Demonstrationen am Nakba-Tag nahe des israelischen Militärgefängnisses Ofer bei Ramallah ereigneten.
„Keines dieser Kinder stellte eine direkte oder indirekte Bedrohung (der Soldaten) dar, als sie erschossen wurden. Diese Taten der israelischen Soldaten könnten ein Kriegsverbrechen bedeuten“, erklärte Rifat Kassis, der Sprecher der Menschenrechtsorganisation Defence for Children International, wenig später der Öffentlichkeit. Vom Tatort existieren neben den Überwachungsbildern auch Tonaufnahmen eines Fernsehteams, die als Beweismittel in einer audioballistischen Analyse klären sollen, wie und aus welcher Richtung auf die beiden unbewaffneten palästinensischen Jugendlichen geschossen wurde. Die entscheidende Frage ist, ob es zum Einsatz von scharfer Munition oder von Gummigeschossen gekommen ist, wie die Soldaten des israelischen Militärs zu ihrer Verteidigung aussagten. Die Untersuchung soll nun die Morde aufklären.
Zwei Jahre später entwickelt Lawrence Abu Hamdan für den Portikus die Arbeit Rubber Coated Steel, der es gelingt, die Ereignisse zu rekonstruieren und die am Tatort aufgezeichneten Töne als lesbare Bilder sichtbar werden zu lassen. Seine raumgreifende Installation setzt sich aus visualisierten Frequenzbildern der Tonspuren und gefundenen Videomaterialien zusammen, die, in der Architektur einer Schießanlage arrangiert, auch den Verlauf der Ereignisse dokumentieren. Bevor jedoch die Videoinstallation Rubber Coated Steel entstand, wurden Hamdans Erkenntnisse und die zusammen mit dem Londoner Institute of Forensic Architecture erstellten Berichte als juristische Beweismittel gegen die israelischen Soldaten eingesetzt, um ihren Verstoß gegen das Waffenabkommen mit dem Vereinigten Staaten vor dem Kongress in Washington, D.C. zu belegen.
Die Deutungskraft, die dem auditiven Material in diesem konkreten Fall zukommt, lässt sich auch in der Bedeutung wiederfinden, die Hannah Arendt dem Zuhören und Sehen für den Verstehensprozess zuschreibt. 1961 wollte sie dem Prozess gegen den SS-Obersturmbannführers Adolf Eichmann vor dem Jerusalemer Bezirksgericht persönlich beiwohnen und schlug dem The New Yorker auf eigenen Wunsch vor, die Gerichtsverhandlungen als Beobachterin zu begleiten. Diese Entscheidung begründete sie in einem Brief an ihren früheren Lehrer Karl Jaspers: „[…] Ich würde es mir nie verziehen haben, nicht zu fahren und mir dies Unheil in seiner ganzen unheimlichen Nichtigkeit in der Realität, ohne die Zwischenschaltung des gedruckten Wortes, zu besehen. Vergessen Sie nicht, wie früh ich aus Deutschland weg bin, und wie wenig ich im Grunde von dieser Sache direkt mitgekriegt habe.“ 1 Arendt war darauf vorbereitet, einem Monster der Grausamkeit zu begegnen. Im Prozess erfuhr sie allerdings keine Bestätigung, sondern erlebte eine Person, die vom Schreibtisch aus Anweisungen befolgte, erteilte und sich den Konsequenzen ihres Handelns kaum bewusst schien. So entwickelte Arendt in ihrem Abschlussbericht die Denkfigur der „Banalität des Bösen“ 2 , für die sie von vielen Seiten scharf kritisiert wurde, die aber heute unser Verständnis von der Grausamkeit der Verbrechen an den Juden maßgeblich prägt.
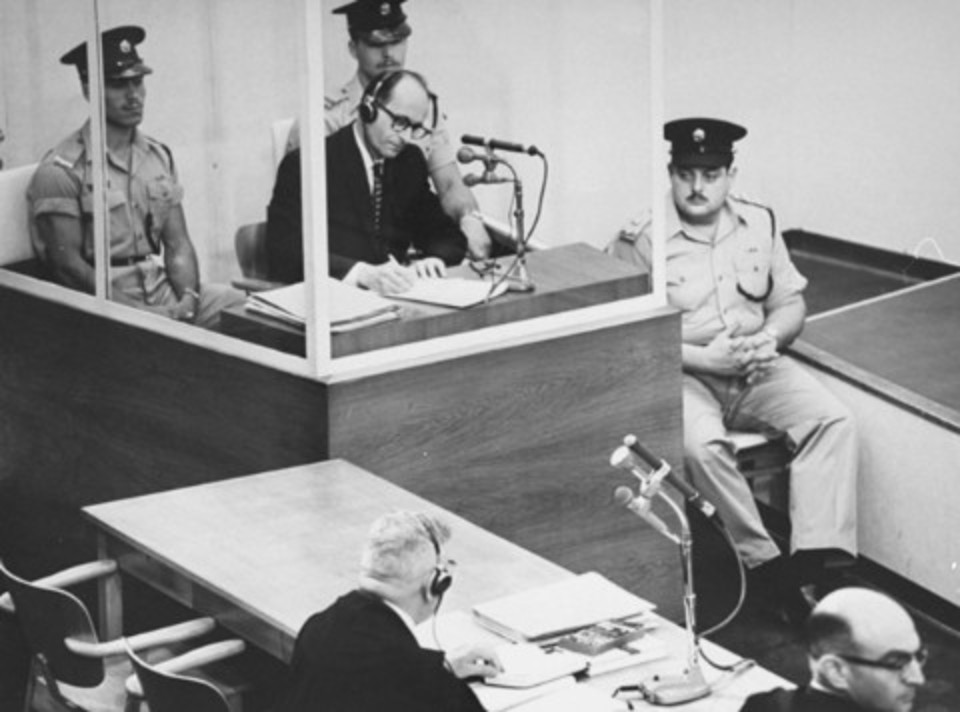
Adolf Eichmann, Foto: United States Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., Fotografie #65268, Courtesy des Israelischen Regierungspressebüros
Ähnlich wie Arendt findet Hamdan im genauen Hinschauen und Analysieren den Schlüssel, um das Unfassbare zu verstehen. Seine Untersuchung des Tonmaterials und die präzise Auswertung der Ergebnisse sind der Versuch, den tatsächlichen Einsatz der scharfen Munition gegen die Jugendlichen zu beweisen und das Verbrechen gerecht aufzuklären. Wie Arendt die Subjektivität ihres Berichts klar definierte, so reflektiert Hamdan die Bedingungen seiner Analyse, indem er den technologischen Apparat, der zwischen Ereignis und Urteil geschaltet ist, ausstellt. Er zeigt die visualisierten Frequenzbilder, präsentiert die relevanten Videoausschnitte und macht die Schüsse im Portikus immer und immer wieder hörbar. Die Situation, die wir in der Ausstellung erleben, ist nicht nur die minutiöse Rekonstruktion des Ereignisses, sondern eröffnet auch die Möglichkeit nachzuvollziehen, wie die zur Verfügung stehenden Beweise analysiert, ausgewertet und interpretiert wurden. Rubber Coated Steel sucht Gerechtigkeit und reflektiert dabei, anders als juristische Berichte, wie sich fragmentarische Beweise zu einer Schlussfolgerung formieren.